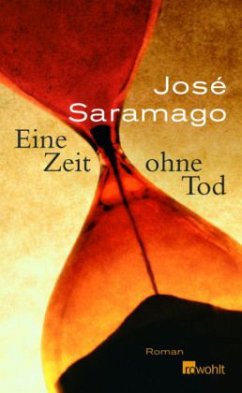José Saramago über eine Gesellschaft, in der niemand stirbt: spannend, kunstvoll, philosophisch.
Es ist der 1. Januar in einem nicht näher bezeichneten Land. Etwas, wofür es kein Beispiel in der Geschichte gibt, geschieht: An diesem Tag stirbt niemand. Und auch am folgenden Tag nicht, und am darauffolgenden. Selbst die Königinmutter, bei der es aussah, als würde sie den Jahreswechsel nicht mehr erleben, verharrt im Sterben. Der Tod streikt, so eine Reporterin. Die Regierung scheint entschlossen, den sich anbahnenden demographischen Problemen die Stirn zu bieten; die katholische Kirche ist in ihren Grundfesten erschüttert, denn ohne Tod keine Auferstehung. Die Gesellschaft spaltet sich: einerseits die Hoffnung, ewig zu leben, andererseits der Schrecken, nie zu sterben. Eines Tages findet der Direktor des nationalen Fernsehens einen Brief auf dem Tisch (der Umschlag ist violett, offenbar von einer Frau beschriftet), von dessen Inhalt er umgehend den Ministerpräsidenten in Kenntnis setzt ... Saramago führt seine in "Die Stadt der Blinden" begonnenen Experimente mit philosophisch-sozialen Fragen fort und erweist sich einmal mehr als großer literarischer Deuter der Welt. Seine Zeitzeugenschaft ist unerbittlich kritisch, künstlerisch gewagt und von einem skeptischen Humanismus geprägt.
Es ist der 1. Januar in einem nicht näher bezeichneten Land. Etwas, wofür es kein Beispiel in der Geschichte gibt, geschieht: An diesem Tag stirbt niemand. Und auch am folgenden Tag nicht, und am darauffolgenden. Selbst die Königinmutter, bei der es aussah, als würde sie den Jahreswechsel nicht mehr erleben, verharrt im Sterben. Der Tod streikt, so eine Reporterin. Die Regierung scheint entschlossen, den sich anbahnenden demographischen Problemen die Stirn zu bieten; die katholische Kirche ist in ihren Grundfesten erschüttert, denn ohne Tod keine Auferstehung. Die Gesellschaft spaltet sich: einerseits die Hoffnung, ewig zu leben, andererseits der Schrecken, nie zu sterben. Eines Tages findet der Direktor des nationalen Fernsehens einen Brief auf dem Tisch (der Umschlag ist violett, offenbar von einer Frau beschriftet), von dessen Inhalt er umgehend den Ministerpräsidenten in Kenntnis setzt ... Saramago führt seine in "Die Stadt der Blinden" begonnenen Experimente mit philosophisch-sozialen Fragen fort und erweist sich einmal mehr als großer literarischer Deuter der Welt. Seine Zeitzeugenschaft ist unerbittlich kritisch, künstlerisch gewagt und von einem skeptischen Humanismus geprägt.

Gestorben wird nicht mehr: José Saramagos morbide Fabel / Von Anja Hirsch
Man stelle sich vor, alle würden erblinden - Als-ob-Spiele dieser Art, wie etwa in "Die Stadt der Blinden", liebt der portugiesische Schriftsteller José Saramago, mit ihnen erprobt er Möglichkeiten und erzählt an ihnen Gleichnisse. In seinem neuen Roman "Eine Zeit ohne Tod" treibt der fast Fünfundachtzigjährige dieses Spiel vergnügt auf die Spitze und lebt eine kühne Allmachtsphantasie aus: Er schafft den Tod kurzerhand ab. Es wird einfach nicht mehr gestorben, und zwar um Schlag zwölfe in einer Silvesternacht in einem ganzen Land.
Feuerwehrmänner ziehen Sterbende aus brennenden Häusern, doch die atmen einfach weiter, über Tage, Wochen, Monate. Unfallopfer weigern sich plötzlich zu sterben. Lebenstüchtige dagegen atmen spontan auf, weil kein drohendes Ende sie bremst. Nur die Kirchenvertreter sind ratlos und bangen um ihren theologischen Kern, denn wo kein Tod, da keine Auferstehung. Und von den Bestattern hört man Klagen, ganz zu schweigen von den Versicherungsunternehmern. Saramago exerziert seine kühne Idee wie eine Etüde mit wechselnder Klangfarbe, so wie er in früheren Romanen andere Szenarien mit anderen Prämissen durchkonjugierte.
Auch "Eine Zeit ohne Tod" will etwas lehren. Doch spart sich Saramago den erhobenen Zeigefinger - und liefert stattdessen ein bizarres Kabinettstück, das man selbst entschlüsseln darf. Zunächst, um das gewaltige Ausmaß zu sichten, ohne viel Pathos aus der Vogelperspektive: Der ausbleibende Tod bewirkt eine nationale Katastrophe, die zu kollabieren droht, als erst Einzelne, dann Massen auf die naheliegende Lösung verfallen, ihre halbtoten Verwandten über die Grenze zu tragen, wo sie flugs die Augen schließen und ruhen können in fremder Erde; später trägt man sie einfach tot zurück. Manche dieser Fälle aber bleiben dubios: Ist das nun Mord oder legale Sterbehilfe? Die angrenzenden Staaten betrachten das unheimliche Szenario äußerst skeptisch. Doch wie wehrt man sich, nachdem Verhandlungen gescheitert sind, gegen Feinde, die nicht sterben, wenn man sie erschießt?
Der Stoff tangiert philosophische Fragen, und Saramago dreht und wendet sie gewohnt souverän aus der Distanz eines auktorialen Erzählers, wenn nicht gar eines ganzen Erzählerkollektivs. Das weiß um die natürlichen Widersprüche dieser konjunktivistischen Konstruktion, zeigt aber Fabulierlust am Gedankenexperiment, und so folgt dem Überblick aus der Totalen die Naheinstellung, das Einzelschicksal. Auch dieses Mittel, Mitleid zu erwirken, kennt man aus Romanen des Nobelpreisträgers.
Noch kühner nun als die Idee, den Tod zu beurlauben, ist die Figur, auf die Saramago jetzt überblendet: Er stellt sich "Tod" höchstpersönlich vor und verleiht ihm menschliche Züge. Das wirkt entwaffnend naiv und berührt - sagen wir - auf archaischer Ebene. Tod teilt nach einem Jahr brieflich mit, dass ab Neujahr wieder "normal" gestorben werde. Das Töten habe Tod unterbrochen, um den Menschen eine Lektion zu erteilen. Die "kostenlose Probephase" sei aber nun vorbei, doch gestehe Tod seinen Fehler ein, bislang allzu schreckhaft überrumpelt zu haben, und informiere künftig eine Woche vor Ablauf der Lebensfrist jeden Einzelnen per violettem Brief. Das gebe Zeit, alles zu ordnen. So spielt Saramago auch dieses durch und schreibt auf seine spitzbübische Art eine kurze Chronik nicht des ausbleibenden, dafür nun des angekündigten Todes. Jetzt streift er nicht mehr die aktuellen Diskurse, Überalterung und demographische Probleme, stattdessen aber die Tücken der Bürokratie, und das ist vielleicht die größte Entmachtung, die er dem Tod jetzt zuzufügen gedenkt: Er degradiert ihn einfach zum Buchhalter, zur ausführenden Gewalt einer Organisation, die normalerweise zuverlässig tötet.
Einmal jedoch nicht. Ein Mensch wird schlicht vergessen - ein banales Datenspeicherproblem im Zettelkasten, der die Lebenszeit vermerkt. Tod wandelt sich also ein drittes Mal, nun vom beleidigten Buchhalter mit Erziehungsauftrag, der seinen Ruf verbessern will, in die anziehende, unerkannt bleibende "dame tod", die ihre ganz eigenen Sorgen hat. Sie, die doch eigentlich töten soll, droht sich in jenen vergessenen Mann zu verlieben. Der Roman läuft zielstrebig auf eine Vereinigungsszene hin - "dame tod", derart schwach geworden, schläft zum ersten Mal (in ihrem "Leben"?) erschöpft ein, was selbstredend arge Folgen hat. "Am darauffolgenden Tag starb niemand" - das Buch endet mit dem Satz, mit dem es so kühn begann.
"Eine Zeit ohne Tod" ist einerseits ein Reflexionsstück ganz im Stile von Saramagos älteren Romanen. Ein literarischer Totentanz, der, weil er mit dem Sterben versöhnt, indem er veranschaulicht, wie es ohne den Tod wäre, auch in der Tradition des memento mori steht, diese aber spielerisch bricht. Noch ein weiteres Panorama öffnet sich, führt man sich die verführte "dame tod" vor Augen, die, so vermenschlicht, die Geschichte einer kollektiven Abwehr dokumentiert, das Entstehen von naivem Bildrepertoire, das Menschen brauchen, um dem Horror vor dem letzten Atemzug das Unheimlich-Verschwommene zu nehmen.
Daneben vernimmt man Saramagos Lieblingsthemen, seine Rede gegen starre Ordnungssysteme und falsch verstandene Demokratien. Doch ist der Roman keineswegs theorielastig, sondern leicht federnd geschrieben, mit einer Freude am Fabulieren, am Ausdenken immer neuer Nuancen, die Saramago nur einer kleinen Weichenstellung am Anfang seiner folgenden Geschichte abgewinnt und die man lesend mitüberlegt, die morbiden, absurden Szenerien nachbildend, die sich ins Gedächtnis einprägen, als Warn-Imagos und Aufforderung, künftig mehr an den Tod zu denken.
José Saramago: "Eine Zeit ohne Tod". Roman. Aus dem Portugiesischen übersetzt von Marianne Gareis. Rowohlt Verlag, Reinbek 2007. 253 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Dieser Roman des portugiesischen Nobelpreisträgers hat Rezensentin Anja Hirsch rundum Vergnügen bereitet. Sie freut sich an der "kühnen Idee", mit der Saramago anhebt, und an den Variationen, durch die er sein "Gedankenexperiment" dann schickt. Dabei attestiert sie dem Autor "Fabulierlust" und eine souveräne Naivität, mit der er an die archaische Angst vor dem Tode rührt. Die Freude der Rezensentin an den narrativen Verwicklungen wird in ihrer Besprechung außerdem grundiert von ihrem Respekt für dieses saramago-typische "Reflexionsstück" über totalitäre Bürokratien und "falsch verstandene Demokratien" (was immer das sein soll). Saramagos kluges Spiel mit der Erzählperspektive hat Hirsch ebenso überzeugt wie seine souveräne Darstellung von Macht und Ohnmacht des Todes als personifizierte 'dame tod'. Ein "literarischer Totentanz", urteilt sie, der den Leser mahnt, sich mehr mit dem Tod zu beschäftigen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Bei allem Realismus, bei allem Engagement ist Saramagos Kosmos das Terrain der großen Geheimnisse, der wahren Mirakel, die resistent sind gegen Deutung, Aufschluss, Klärung Frankfurter Rundschau