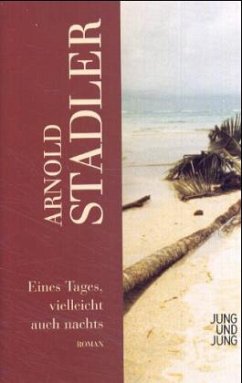Von Gerard Manley Hopkins, dem englischen Priester und Dichter, sind einige Journale und Tagebücher erhalten geblieben und lange nach seinem Tod veröffentlicht worden. Die Journale kann man mit gutem Recht Landschaftsbücher nennen, die früheren Tagebücher Wörterbücher. Den Journal- und Tagebuchschreiber stellt man sich am besten vor als Spaziergänger, der weit und lange geht, viel Zeit und Geduld hat, einen heftigen Ortssinn und einen großen Willen, sich an etwas Wichtiges zu erinnern. Als einen, der nicht auf warmes Wetter wartet, der stehenbleibt und schaut und studiert, der auf alles achtet, auf das Größte wie auf das Winzigste, Nebensächlichste, der am liebsten allein geht und vertrautes Gespräch meidet, weil die Wirklichkeit fremd zu bleiben verdient. Er macht seine Notizen, zeichnet Bäume, Sträucher, Fels, Wolken und findet dabei eine innere Einheit der Welt wieder (fast ein Marcel Proust der Landschaft). So ist die Sprache von Hopkins nicht vertrautes System, sondern, müßte man sagen, von Liebe verfremdet und von seltsamem Reichtum; eine sprachliche Ausnahme, auch heute noch. Diese Übersetzung wurde seinerzeit von Kritik und Lesern gleichermaßen begeistert aufgenommen, der Verlag ist stolz, es wieder vorlegen zu können.

Mit Zigarillos aus Kuba schmeckt das Leben besser: Arnold Stadler schreibt weiter an seinem großen Ich-Buch / Von Pia Reinacher
Ein merkwürdiger Titel irritiert gleich von Anfang an. "Eines Tages, vielleicht auch nachts" heißt der neue Roman von Arnold Stadler, und man runzelt die Stirn: diese deklarierte Unbestimmtheit. Diese absehbare Austauschbarkeit. Will es hier einer mit den Unwägbarkeiten des Lebens aufnehmen? Aber mit welchen? Auch der Schluß des Buches ist irritierend: Es endet mit einer Widmung, dem Freund zugeeignet, "damit es bleibe". Gehört der Satz nun zum Textkorpus? Oder soll man ihn als private Botschaft ignorieren?
Man beginnt zu lesen und wundert sich während der ersten dreißig Seiten über eine seltsame Zerfransung des Themas. Motivisches Urgestein taucht auf, das man aus dem Roman "Ein hinreissender Schrotthändler" (1999) kennt, man stößt aber auch auf Einsprengsel aus dem "Sehnsuchts"-Roman (2002). Vater und Mutter projizieren sich erneut auf die Bildfläche und der alte Hader mit der eigenen Vergangenheit. Wieder wird die Elternwunde besprochen und wie der Schmerzens-Sohn zu dem wurde, was er ist. Auf Anhieb ist klar, daß hier einer daran ist, ganz wie Robert Walser an einem vielfach zerschnittenen Ich-Buch fortzuschreiben. Und man versteht, daß jedes auch noch so winzige Detail, jede zufällige Botschaft, jeder scheinbar unabsichtliche verbale Schlenker Teil eines Bauplans ist, der ein großes Thema umfaßt.
Ob dies in jedem Teil gelingt, ist an dieser Stelle noch längst nicht entschieden. Die Komposition allerdings ist bestechend kalkuliert. Noch immer ist dieser Autor auf der Glückssuche, die zugleich alle Unglücksfährten mitdenkt. Dieses Mal kommt unter der Textoberfläche - kratzt man die Buchstabenfresken nur oberflächlich weg - das uralte Bild von Liebe und Tod zum Vorschein. Am Ende stirbt Franz Marinelli einen ebenso würdigen wie elenden Tod und bekommt, wie er es im Testament angeordnet hat, eine Seemannsbestattung auf der Hochseeyacht eines befreundeten Realitätenhändlers. Am Anfang aber war alles voller Hoffnung. Jene sentimentale Gier, welche die Liebe verheißt - noch immer der Königsweg zum Glück; jenes unbändige Gefühl wider besseres Wissen - und obwohl schon jetzt klar ist, wie es enden wird. Der Schriftsteller ist nach Kuba aufgebrochen, um die Ankunft einer Delegation des Schriftstellerverbandes vorzubereiten.
Vom glühenden Paradies hatte er in seiner unterkühlten Wiener Kindheit geträumt. Die Eltern leben nach der Devise "Umbringen immer, scheiden nie", die Mutter trägt den Sieg über den Vater davon, wenn auch einen Pyrrhussieg. Der Pathologieprofessor hatte gleich nach der Hochzeit mit dem Aufgeben von Suchanzeigen begonnen und für die praktische Durchführung ein Wohnmobil gemietet, das die Mutter "mobile Besamungsstation" nennt. Der Vater wiederum gewöhnt sich daran, von der Mutter Schläge mit dem Schuh zu bekommen, und das Schlagen und Geschlagenwerden rettet das Paar und hält die Beziehung am Leben und "verhinderte das Schlimmste, was vielleicht gar nicht das Schlimmste gewesen wäre". Zwar triumphiert die Witwe nach dem Herzinfarkt des Vaters, der ihn in einem Geschäft für Ehehygiene ereilt; allerdings bleibt ihr dazu nur kurze Zeit: Schon bald fristet sie ein entmündigtes Leben in einem vornehmen Pensionistenheim und schreit von jetzt an nachts ein schrilles "Lügner" ins Dunkle.
Das ist die alte Familienkonstellation mit neuen Masken im literarischen Laboratorium des Arnold Stadler. Wie immer erzählt er das Schreckliche mit schwarzem Humor und funkelnder Ironie und demontiert mit der typischen Mischung aus Hohn, spitzzüngigem Entlarvungssound und kaum kaschierter Melancholie die Fassade des bürgerlichen Ehelebens. Allerdings verharrt der geneigte Leser in diesem ersten Teil wider Willen im abwartenden Halbschläfer-Status; die Neugiermaschine will einfach nicht anspringen - weil das Szenario an anderen Orten bereits virtuoser abgehandelt ist. Dieser erste, zu ausführliche Teil dient als Startrampe, die den Kern der Geschichte viel zu spät hochspickt. Allerdings kommt es im zweiten, im Kuba-Teil, der wiederum einen Erzählmantel abgibt, dann plötzlich ganz anders. Zwar ist der westindische Prospekt, den Arnold Stadler aufspannt, nicht viel mehr als eine Probekulisse für die Suchbewegungen Marinellis; sie kippt im Laufe des Romans von der Farbe Grün ins innerliche, ewigkeitsverheißende Blau des Himmels und der Meere. Aber jetzt wird der Ton plötzlich eindringlich, die Sätze sind durchsetzt mit heftigen Befreiungssignalen, die Indizien für ein wütendes Ausbrechen-wollen Marinellis aus dem Korsett des eigenen Lebens häufen sich.
Hellwach ist man plötzlich und verfolgt den verzweifelten Häutungsversuch, entdeckt wild aufzuckende Zeichen von Übermut, beobachtet das verzweifelte Abstrampeln aus dem Sumpf der Resignation, verfolgt die wilde Flucht vor der schicksalhaften Unglücksfährte. Marinelli weiß genau, was vorgeht; und er bewahrt den Leser an keiner Stelle vor seiner illusionslosen Diagnose. Die Menschen, heißt es an einer Stelle, spielten und verspielten in jeder Situation, selbst beim Glück, sie versuchten sogar, "sich bei der Liebe, im Bett, über die Erregung eines anderen Menschen einen Vorteil zu verschaffen, indem sie vorspielten, mit diesem Menschen glücklich zu sein".
Marinelli aber hat sich jetzt "für das eindeutige, unbezweifelbare, wenn auch vielleicht ebenerdige Glück entschieden und nicht für den Menschen kurz vor dem Orgasmus". Unerwartet lodern Sätze wie "Ich will endlich leben" durch den Text, gefolgt von eiskalten Abrechnungen mit der Vergangenheit, aber auch mit dem Schreiben, dieser elenden Form von Wiederbelebung, die nichts anderes sei, als einem längst Verrotteten Leben einzuhauchen, diese Ekstase aus zweiter Hand. Schreiben als Traum, der im Grunde ein Albtraum ist und aus dem immer gleichen Kapital schöpft: dem Unglück.
In diesem zweiten Teil, in dem Marinelli eine Beziehung mit der kubanischen Schönheit Ramona eingeht, sich zugleich im Netz ihres schwulen Freundes verfängt und eine zwiespältige Liaison mit der alternden Schriftstellerin Rose dirigiert, setzt die wahre Befreiung ein, die Entfesselung. In diesen Passagen verbirgt sich der geheime Sinn, der den Autor und jetzt auch den Leser vorantreibt: die Jagd nach dem prallen Leben, die Suche nach dem einfachen Glück, der Aufbruch aus den Trümmern der Vergangenheit. "Es war alles so viel wie nichts. Und doch hatte er Menschen sagen hören, daß sie glücklich waren, daß es ihn gab." Als er die Wechselbäder von Entzücken und Betrübnis, von Überschwang und Kümmernis hinter sich gelassen hat, bricht er noch einmal auf: Marinelli schwimmt - trotz der Schwimmringe um den Bauch - im Geiste nochmals mutig hinaus, als hätte das Leben einen Sinn, der in der Bewegung zu finden wäre.
An diesem Punkt, ganz vom Schluß her, entschlüsselt sich die feingliedrige Konstruktion dieses Romans mit dem rätselvollen Titel "Eines Tages, vielleicht auch nachts". Es sind Embleme, die Arnold Stadler aufblättert und die den Wechselgang des Lebens darstellen. Bildtafeln auf dem Denkmal der Marinelli-Figur. Sie meinen Tag und Nacht, Leben und Tod, Liebe und Haß, Glück und Unglück. Aber Arnold Stadler wäre nicht er selbst, wenn er dieses Verfahren benennen würde. Die Bedeutung der Tableaus entfaltet sich erst im Zusammenklang von Motto, Pictura und Subscriptio. Das Motto des einen Emblems heißt Unglück, sein Bild zeigt die Kindheit, die Kälte, und sein Text redet von Absterben und Tod in zerrütteten Verhältnissen. Die unterirdische, aber kraftvolle Strömung des Textes läuft aber immer entschiedener auf den Gegenpol zu: Sein Motto heißt Glück, das Bild stellt ein warmes Inselparadies vor, und der Text redet von den Irrfahrten des Glückssuchers. Dieser Bewegung vom Unglück zum Glück ist die alte Metamorphose von "Stirb und werde" einbeschrieben, und auf nichts weniger läuft Stadlers Suche zu.
Arnold Stadler: "Eines Tages, vielleicht auch nachts". Roman. Jung und Jung Verlag, Salzburg und Wien 2003. 188 S., geb., 18,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Da sind sie ja wieder, die Mitglieder der Familie Stadler, nur mit neuen Masken, ruft ebenso gefesselt wie erschöpft Rezensentin Pia Reinacher. Sie hat sich mit allerlei Zweifeln durch das Buch gearbeitet: sich zunächst über den merkwürdigen Titel gewundert, die "seltsame Zerfransung des Themas" am Anfang. Motivisches Urgestein aus anderen Stadler-Büchern tauchte vor ihr auf, Vater und Mutter tauchen auf und der Rezensentin, an Robert Walser erinnert, wurde klar, dass auch Stadler an einem "vielfach zerschnittenen Ich-Buch" weiterschreibt. Die Komposition des Buches findet sie genau kalkuliert. Wie Stadler die Fassade des bürgerlichen Ehelebens demoliert mit einer Mischung aus "schwarzem Humor und funkelnder Ironie", beeindruckt sie. Allerdings dauert es, bis ihr Interesse richtig enfacht ist: Erst beim zweiten Teil des Romans, in dessen Zentrum eine Kuba-Reise steht, findet sie jene Passagen, die für sie den geheimen Sinn des Romans bergen, der den Autor und nun auch die Rezensentin antreiben: die Jagd nach dem einfachen Glück.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Es ist Peter Waterhouse zu verdanken, daß sich das 'Journal' heute wie die Chronik einer poetologischen Revolution liest." (Durs Grünbein, FAZ)