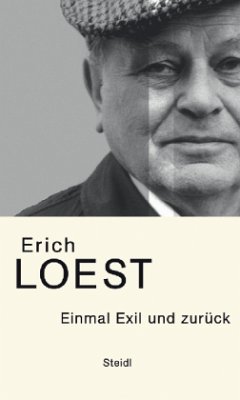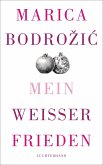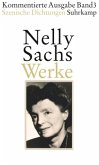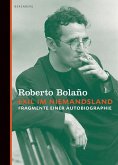Wenn Erich Loest, der große Chronist, auf die deutsche Vergangenheit zurückblickt, behält er die Gegenwart stets im Auge. In seinen Reden und Essays der letzten Jahre bringt Loest deutlich zur Sprache, was zu sagen ist über sein Deutschland, sein Sachsen, sein Leipzig. Er faßt die Gedenkkultur hart an, plädiert für das Fusionieren ostdeutscher Bundesländer und beklagt das intellektuelle Ausbluten seiner Heimatstadt.
Sich und seinen Lesern erspart Loest jede Sentimentalität. Er will sich auch nicht unnötig versöhnen mit den Feinden von gestern und den Gegnern von heute - davon zeugen auch zwei Bühnentexte, die diesen Band abrunden. Farbig wie immer und ganz aus eigenem Erleben gespeist, spricht Erich Loest von guten und schlechten Traditionen, von Gemeinsinn und der Notwendigkeit, sich weiterhin einzumischen.
Sich und seinen Lesern erspart Loest jede Sentimentalität. Er will sich auch nicht unnötig versöhnen mit den Feinden von gestern und den Gegnern von heute - davon zeugen auch zwei Bühnentexte, die diesen Band abrunden. Farbig wie immer und ganz aus eigenem Erleben gespeist, spricht Erich Loest von guten und schlechten Traditionen, von Gemeinsinn und der Notwendigkeit, sich weiterhin einzumischen.

Skeptische Heimatkunde mit Erich Loest
Man muss deutschen Bücherfreunden den Schriftsteller Erich Loest nicht erst vorstellen. Seit mehr als einem halben Jahrhundert erzählt er uns Geschichten, und in all der Zeit konnte er darauf rechnen, dass sie auch gelesen werden, denn immer fanden wir uns selbst darin wieder. Er führte uns tief in die historischen Jahrzehnte, die wir durchlebten und durchlitten. Das begann mit dem Zweiten Weltkrieg, setzte sich fort mit der Teilung Deutschlands, unter besonderer Berücksichtigung des östlichen Landesteils, mündete schließlich in den Ereignissen, die wir als "Wende" bezeichnen.
Ein wortmächtiger Historiker also, dieser Loest? Mit solch einem Titel würden wir ihm nicht gerecht, denn der riefe das Bild eines talentierten Beobachters hervor, der in Sprache umzusetzen weiß, was Augen und Ohren ihm melden. Loest aber ist mehr, und zwar deshalb, weil er nicht nur hingesehen und hingehört und das Wahrgenommene präzis durchdacht hat. Er hat all den deutschen Jammer, all die Aufregung am eigenen Leibe erfahren: in ferner Vergangenheit als Schüler-Soldat während der letzten Kriegsmonate; als Bürger der DDR, der nach all dem blutigen Elend gern an die Botschaften der neuen Herren geglaubt hätte; als Klassenfeind, der seine Unfähigkeit, auch das Unbewiesene zu glauben, mit sieben Jahren Zuchthaus bezahlen musste; schließlich als Auswanderer, der das Stück Lebens- und Schaffenskraft, das die DDR-Diktatoren ihm gelassen hatten, in den Westen zu retten versuchte. Dies mit Erfolg, wie seine Veröffentlichungen in den Westjahren beweisen.
Seit 1990 wohnt Loest wieder in der Stadt seines Herzens, in Leipzig. Er hat seither achtzehn Jahre Zeit gehabt, ein Fazit der erlebten Geschichte zu ziehen, der eigenen und der staatlich deutschen. Einiges von dem, was dabei herauskam, liegt uns vor in einem neuen Buch mit dem Titel "Einmal Exil und zurück". Es ist nicht, wie die meisten seiner Veröffentlichungen, ein Roman, vielmehr eine Sammlung von Aufsätzen, Interviews, Festreden, entstanden, gegeben, gehalten aus verschiedenen Anlässen. Dazu kommen zwei Theaterstücke, von denen das eine 2006 in Halle aufgeführt, das andere im Sammelband zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Was sagt uns dieses Bündel von Äußerungen?
Vom jeweiligen Gegenstand her unterscheiden sie sich natürlich, immerhin präsentiert das Buch sechsundzwanzig Beiträge, die zwar den Autor, aber nicht unbedingt das Thema gemeinsam haben. Und doch lässt sich eine grundsätzliche Übereinstimmung aller ausmachen, ob sie nun das gegenwärtige Leipzig oder eine andere Stadt, die ostdeutsche Gesamtsituation oder Vertreter ostdeutscher Politik und ostdeutschen Kultur- und Geisteslebens behandeln.
Man könnte sagen, dass man Enttäuschung in ihnen findet, und zwar umso mehr, je später sie verfasst sind. Das soll nicht heißen, Erich Loest trete uns hier als Übelnehmer entgegen, als jemand, der der Welt nicht verzeihen kann, dass sie ihm schon wieder einmal nicht das Paradies serviert, nach dem er sich immer gesehnt hat und das ihm unter verschiedenen Parolen mehrmals verheißen wurde. Für so etwas ist dieser Mann zu klug, nach einem langen Leben voller Erfahrungen sogar zu weise. Aber auch Weisheit schützt nicht vor Traurigkeit.
Loest zählt jetzt zweiundachtzig Jahre, ein Alter, in dem ein Realist längst begriffen hat, dass Träume sich selten erfüllen, und wenn, dann nur ansatzweise, niemals ganz. Sein letzter Traum dürfte gewesen sein, dass seine Heimatregion nach der Wende eine Neugeburt erlebt, wiederaufersteht als die Art Heimat, die er so gern in ihr geliebt hätte. Aber dort, wie auch sonst in Deutschland, gibt es nach wie vor Menschen, wie sie das Land auch in den schlimmen Jahren bevölkerten. Solche, die vor 1945 zuließen, was geschah, es danach taten und weiterhin tun. Ganz offenkundig ist der Autor zu dem Schluss gekommen, dass allzu viele Erdenbewohner in den Jahrtausenden ihrer Entwicklung allzu wenig aus ihrem mannigfachen Versagen gelernt haben. Er spricht das nirgendwo wörtlich aus, doch aus sämtlichen Zeilen dieses späten Buches dringt das wehmütige Wissen darum.
Die beiden Theaterarbeiten beweisen am eindringlichsten, wie intensiv der Zeitgenosse und Gesellschaftskritiker Loest mit den hartnäckigen Fehlerschatten kämpft. Das erste Stück, "Die Prahlerin" genannt, greift die Geschichte der Hallenser Zuchthäuslerin Erna Dorn auf, die im Zusammenhang mit dem 17. Juni 1953 zur Hetzreden kreischenden KZ-Kommandeuse hochstilisiert, ohne Beweise verurteilt und hingerichtet wurde. Loest nimmt nicht etwa ihre Partei, er zeigt sie als das, was sie war, eine beschränkte, nicht sonderlich sympathische Frau aus der Hefe des Volkes. Ihm geht es darum, was von einem Regime zu halten ist, das in seiner Politik solche Mittel nötig hat. Das andere Stück, "Ratzel speist im ,Falco'", führt uns einen Klüngel einstiger SED-Funktionäre vor, die im Leipzig von heute fein essen, dabei ihrer erfolgreichen Vergangenheit gedenken und obendrein Pläne schmieden, wie die Vergangenheit wieder zur Gegenwart gemacht werden kann. Als Figuren im geplanten Schachspiel werden nicht bloß Personen genannt, die wir aus alten Nachrichten kennen, besonders denen von 1989/90, sondern auch einige, die in der heutigen Politik zu finden sind. Man könnte beim Lesen das Fürchten lernen, würde nicht auch deutlich, dass Loest, allen bösen Erfahrungen zum Trotz, keine Angst vor solcher Kamarilla hat. Was sie in ihm auslösen, ist ablehnender Hohn - der allerdings ist gesättigt mit Trauer, die aus der Erkenntnis kommt.
SABINE BRANDT
Erich Loest: "Einmal Exil und zurück". Steidl Verlag, Göttingen 2008. 284 S., geb., 16,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Sabine Brandt schätzt Erich Loest als Erzähler seiner eigenen Geschichte, die zugleich ein halbes Jahrhundert deutscher Geschichte umfasst, und sie betont als besondere Qualität, dass der Autor eben nicht nur beobachtet und reflektiert, sondern als junger Soldat, DDR-Bürger, der als "Klassenfeind" sieben Jahre eingesperrt wurde, und als späterer Exilant "all den deutschen Jammer" des 20. Jahrhundert selbst durchlebt hat. In seinem jüngsten Buch, das Reden, Interviews, Aufsätze und zwei Theaterstücke versammelt, zieht er, seit 1990 wieder in seiner Heimatstadt Leipzig lebend, Bilanz aus der Zeit seit der Wende. Für Brandt eint die Beiträge vor allem ein Gefühl der "Enttäuschung", die sich allerdings nicht als Groll, sondern als Trauer manifestiert. Und so durchzieht dieses Buch, so unterschiedlich die einzelnen Texte auch thematisch sind, die altersweise Gewissheit, dass die meisten Menschen aus ihren Fehlern nichts gelernt haben, so die Rezensentin, die Loests Auseinandersetzung mit den "hartnäckigen Fehlerschatten" seiner Zeit am eindruckvollsten in den beiden Theaterstücken vorgeführt sieht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH