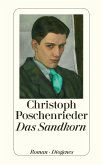»Ich werde mich nicht mehr bewegen können«, sagt die Mutter des Ich-Erzählers in Björn Kerns Roman. »Ich werde nicht mehr schlucken können, und am Ende ersticke ich.«
Das Leben in der kleinen Familie aus Vater, Mutter und Sohn wird kompliziert, grotesk, eine Belastung für die Nerven, eine Herausforderung für die Liebe und für die Bereitschaft, zu bleiben.
Längst führt der Sohn ein eigenes Leben. Aber die Krankheit der Mutter zwingt ihm eine Nähe auf, die alles auf den Prüfstand stellt, das Kindsein, das Erwachsensein. Der Sohn läuft nicht weg, hilft der Mutter, hilft dem Vater, hilft sich selbst. Die Mutter ist vital, kämpft um jeden Fußbreit Leben, provozierend, eine Zumutung, liebenswert, heroisch, unerträglich.
Björn Kern erzählt mit Witz, Liebe und gänzlich unsentimental davon, was es bedeutet, mitten im Leben Abschied nehmen zu müssen. Seine präzise, poetische Sprache trägt den Leser durch diesen aufwühlenden und bewegenden Roman voller Szenen und Dialoge, die man nicht vergisst.
Das Leben in der kleinen Familie aus Vater, Mutter und Sohn wird kompliziert, grotesk, eine Belastung für die Nerven, eine Herausforderung für die Liebe und für die Bereitschaft, zu bleiben.
Längst führt der Sohn ein eigenes Leben. Aber die Krankheit der Mutter zwingt ihm eine Nähe auf, die alles auf den Prüfstand stellt, das Kindsein, das Erwachsensein. Der Sohn läuft nicht weg, hilft der Mutter, hilft dem Vater, hilft sich selbst. Die Mutter ist vital, kämpft um jeden Fußbreit Leben, provozierend, eine Zumutung, liebenswert, heroisch, unerträglich.
Björn Kern erzählt mit Witz, Liebe und gänzlich unsentimental davon, was es bedeutet, mitten im Leben Abschied nehmen zu müssen. Seine präzise, poetische Sprache trägt den Leser durch diesen aufwühlenden und bewegenden Roman voller Szenen und Dialoge, die man nicht vergisst.

Abschied von der Mutter: Ein Roman von Björn Kern
Nicht der Engel mit dem Flammenschwert vertreibt heutzutage aus dem Paradies ruhiger Alltäglichkeit, sondern die ärztliche Diagnose. "Es ist keine Arthrose", heißt es auf der ersten Seite dieses schmalen Romans. Vater, Mutter, Kind: die Figurenkonstellation des Buches ist denkbar einfach, aber von diesem Satz an ist nichts mehr alltäglich im Leben der Familie. Denn der Befund, der nie beim klinischen Namen genannt wird, bedeutet das Todesurteil für die lebensfrohe Mutter. Eine Muskelkrankheit hat die Lehrerin befallen; und sie selbst kennt klarsichtig die Stationen ihres unaufhaltsamen Siechtums: "Ich werde mich nicht mehr bewegen können, sagte sie, ich werde nicht mehr schlucken können, und am Ende ersticke ich." Genauso trifft es ein, das medizinische Wunder bleibt aus, am Ende des Buches sitzt der Sohn am Bett seiner toten Mutter, die sich zuletzt nur noch mit minimalen Kopfbewegungen verständlich machen konnte. Eine andere Form von Alltäglichkeit, nur eben kein Paradies mehr.
Nüchtern erzählt Björn Kern die Geschichte vom Zerfall einer Familie. Der Sohn wird zum Chronisten der Krankheit; aus der Ich-Perspektive schildert er die Hilflosigkeit seines Vaters, das eigene Schwanken zwischen Anteilnahme und Verdrängung, die Versuche der Mutter, sich auf immer neue technische Hilfsmittel einzustellen. Die Abfolge dieser Geräte spiegelt die zunehmende Schwäche derer, die auf sie angewiesen sind: Am Anfang steht das automatische Lesegerät, das die Seiten eines Buches umwenden soll und dabei - seltener Moment des Humors - schon mal den neuen Roman von Günter Grass malträtiert. In immer größerem Tempo kommen kompliziertere Apparaturen hinzu: eine Atemmaschine, ein elektrisches Bett, ein Hebekran, ein aufwendiger Rollstuhl, der, wie es bewundernd heißt, "vierzehn Funktionen und halb so viele Motoren" hat, und schließlich ein Sprachcomputer. Ein stattlicher Maschinenpark gehört bald zum Inventar des Kleinbürgerhaushalts; im ehemaligen Kinderzimmer stapeln sich leere Verpackungen und Ladegeräte für die vielen Batterien.
So entstehen Bilder aus dem Pflegealltag, den die Verordnungen des Gesundheitswesens mit Gebührensätzen zu regulieren versuchen. Der Kontrollbesuch des Krankenkasseninspektors gehört zu den wenigen und unerwünschten Abwechslungen im Leben der drei Menschen, die sich immer mehr der Außenwelt verschließen. Das freilich führt den Roman an seine Grenzen. Kern konzentriert sich ganz auf die innerfamiliären Veränderungen und vernachlässigt darüber die übrigen Personen seiner keineswegs hermetischen Welt. Die namenlose Freundin des Ich-Erzählers bleibt ebenso blaß wie die Freundinnen der Mutter, die - an der Grenze zur Karikatur - mit einer seltsam diffusen Gruppenidentität ausgestattet werden.
Wiederholt versuchen Mutter und Sohn aus dem Gefängnis der engen Wohnung auszubrechen. Eine Reise nach Marseille wird zum Höhepunkt dieser kleinen Fluchten; am Ende schiebt der Sohn noch einmal das Bett seiner inzwischen fast völlig gelähmten Mutter durch die Straßen der Heimatstadt bis in den Stadtpark. Man mag Zweifel daran haben, ob diese Szene die Abmessungen von Krankenbetten und modernen Wohnhausfahrstühlen berücksichtigt - auf alle Fälle bleibt dieses Bild eine anrührende Ikone im Kampf gegen die Unerbittlichkeit der Krankheit.
Hat das jedoch, was menschlich anrührt, auch literarischen Belang? Kein Zweifel kann daran bestehen, daß sich der knapp dreißigjährige Björn Kern für sein zweites Buch (der Roman "Kipppunkt" erschien 2001) ein schwieriges Sujet gewählt hat, das zur Zeit eine erstaunliche Konjunktur nicht nur auf dem deutschen Buchmarkt erfährt. In den letzten Jahren haben unter anderen Jakob Hein, Lydia Flem oder jüngst Angelika Overath den Abschied von ihren kranken und schwachen Müttern zum Thema ihrer Bücher gemacht. Sie alle standen vor der selbstgewählten Aufgabe, ihrer Leserschaft Persönlichstes darzulegen und für den Schmerz, die Trauer und die Hilflosigkeit des Verlassenwerdens Worte zu finden, die über unmittelbares Betroffensein hinausgehen. Im besten Fall kann die Trauer zum Antrieb für ein genaues und unsentimentales Erzählen werden, das die Schilderung des Einmaligen und Privaten transparent werden läßt für die allgemeinen Bedingungen unserer Existenz, seien sie nun im Gesellschaftlich-Sozialen, in den komplizierten Vorgängen der Psyche oder der Hinfälligkeit alles menschlichen Lebens zu suchen.
In diesem Chor der verwaisten Erzähler kommt Björn Kern eine respektable Stimme zu. Dem Protagonisten seines Romans ist das Leben der Mutter vor ihrer Krankheit erstaunlich gleichgültig, die Stationen des unausweichlichen Abschieds dokumentiert er aber mit teilweise beklemmender Präzision. Wenn Leser des Buches durch Kerns lakonische Sprache an eigene Erfahrungen der Ohnmacht angesichts von Krankheit und Tod und damit an die Grenzen ihrer Selbstbestimmung erinnert werden, so ist das kein geringes Lob für einen jungen Autor.
Björn Kern: "Einmal noch Marseille". Roman. Verlag C. H. Beck, München 2005. 127 S., geb., 12,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Der junge Autor Björn Kern schildert in seinem zweiten Roman die Geschichte des gesundheitlichen Niedergangs einer Mutter und den Auswirkungen auf die Familie, vor allem auf den Sohn, der der Ich-Erzähler ist. Eine Muskelerkrankung zwingt die "lebensfrohe" Frau erst ins Bett, lähmt sie dann zusehends, bis sie sich in einem Maschinenpark wiederfindet, der nach und nach die Funktionen ihrer Organe übernimmt. Dargestellt werden mit psychologischer und sprachlicher Genauigkeit "das Schwanken zwischen Anteilnahme und Verdrängung" des Sohns, der Verlust der Außenwelt für die Beteiligten. Hier gibt es dann, bedauert die Rezensentin Sabine Doering, auch Schwächen. Manche der eingeführten Figuren bleibt so allzu blass oder zu schematisch. Für ganz große Literatur hält Doering das Buch wohl nicht, erkennt aber doch eine "respektable Stimme" und lobt die "teilweise beklemmende Präzision".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH