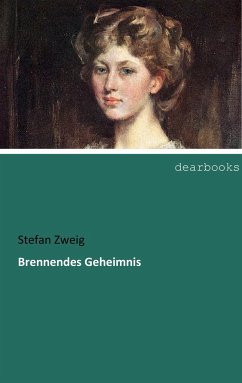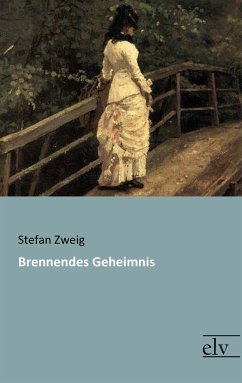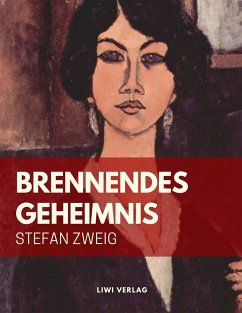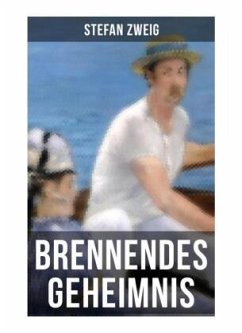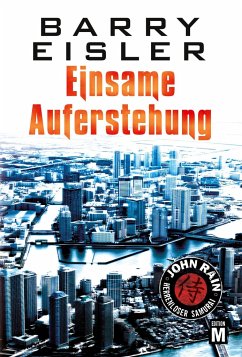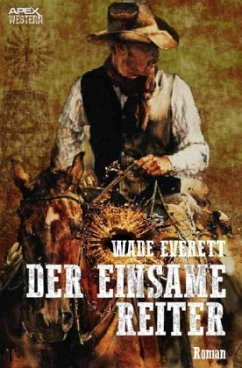Nicht lieferbar

Einsame Tiere
Roman. Deutsche Erstausgabe
Übersetzung: Torberg, Peter
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Okanogan County, Anfang der 1930er Jahre. Eigentlich hat sich Sheriff Russel Strawl zur Ruhe gesetzt. Er ist müde geworden, seine Hände zittern beim Schießen. Doch dann kommt es im Indianerreservat zu einer Reihe grausamer Ritualmorde, und Strawl soll ermitteln. Ein letztes Mal noch steigt er in den Sattel und begibt sich in einen Abgrund der Gewalt. Dort holt ihn auch seine eigene Vergangenheit ein. Denn vor langer Zeit hat Strawl schwere Schuld auf sich geladen, die nie gesühnt wurde. So wird aus dem Jäger nach und nach ein Gejagter, und als er in Verdacht gerät, die Morde selbst began...
Okanogan County, Anfang der 1930er Jahre. Eigentlich hat sich Sheriff Russel Strawl zur Ruhe gesetzt. Er ist müde geworden, seine Hände zittern beim Schießen. Doch dann kommt es im Indianerreservat zu einer Reihe grausamer Ritualmorde, und Strawl soll ermitteln. Ein letztes Mal noch steigt er in den Sattel und begibt sich in einen Abgrund der Gewalt. Dort holt ihn auch seine eigene Vergangenheit ein. Denn vor langer Zeit hat Strawl schwere Schuld auf sich geladen, die nie gesühnt wurde. So wird aus dem Jäger nach und nach ein Gejagter, und als er in Verdacht gerät, die Morde selbst begangen zu haben, nimmt er das Gesetz in die eigene Hand. Am Ende einer Blutspur, die Strawl bis an den Rand der Zivilisation führt, wartet der wahre Täter auf ihn ... Seit Langem hat kein Autor derart kraftvolle, unerbittliche Westernliteratur jenseits aller Mythen geschaffen. Mit einer Sprache, die rau ist und zugleich poetisch, evoziert Bruce Holbert den Herzschlag einer Zeit, in der niemand unversehrt davonkam. "Einsame Tiere" ist ein Roman über die Fadenscheinigkeit aller Moral, wenn die dunkle Seite im Menschen hervorbricht.