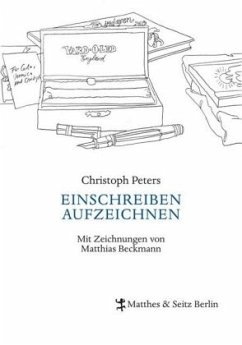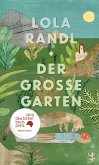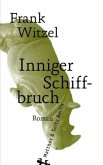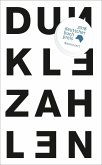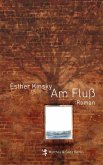Ein Geschenk, ein neuer Füller, wird zum Auslöser für die tägliche Niederschrift. Christoph Peters schreibt sein neues Arbeitsgerät ein, und lässt den Leser für ein Jahr an den Beobachtungen und Gedanken seines Alltags teilhaben. Scheinbar Banales wird beschreibenswert, Routine wird zum Ereignis. Matthias Beckmann hat Zeichnungen dazu gefertigt, die den Charakter der Notate präzise widerspiegeln und Peters Alltag illustrieren.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Wer derart verschwenderisch seine Einfälle in die kleine Form gießen kann, der muss ja jede Menge Talent haben, mutmaßt Christoph Schröder angesichts von Christoph Peters' Buch, das sich der Einschreibeprozedur eines Füllers verdankt. Jeden Tag eines Jahres setzt sich der Autor zu diesem Zweck hin und schreibt in ein Notizbuch - Alltagsbeobachtungen, Erinnerungen, Auratisches, und all das immer munter mischend. Schröder gefällt daran besonders der Moment, wenn sich die Protokollierungen quasi selbstständig machen, neue, ungeahnte Verbindungen schaffen und Bögen schlagen. So naiv das alles auf den ersten Blick vom Autor gemacht scheint, so sehr erkennt Schröder doch eine ausgefuchste Poetologie dahinter, die so manches Disparate zusammenführt. Daraus entstehen zum Teil wunderbare Miniaturen, versichert der Rezensent.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Ein Jahr lang hat der Schriftsteller Christoph Peters sich selbst und die Welt beobachtet: Mit gehörigem Abstand kommen die Notizen nun heraus
Schriftsteller bekommen von Bekannten, die nicht genau wissen, wie Schriftsteller zu beschenken seien, bevorzugt Notizbücher geschenkt, in allen Formaten und blanko, kariert oder liniert, "damit du was für deine Notizen hast". Darüber freut man sich dann, fängt das Heft auch an, es werden fünf, zehn, vielleicht sogar dreißig Seiten gefüllt, und dann verschwindet es in irgendeiner Schublade, aus der man es drei Jahre später zufällig wieder ausgräbt, was unausweichlich die Frage aufwirft: wie weiter?
Christoph Peters hat vor acht Jahren, nicht von Bekannten, sondern von seiner Frau, einen in England gefertigten silbernen Füller geschenkt bekommen. Einen Füller, das sollte jeder wissen, wissen aber viele nicht, muss man einschreiben, und das, schreibt Peters, "kann Tage oder Wochen dauern. Am besten man hält sich an das Naheliegende, damit der Fluss nicht ins Stocken gerät. Darum geht es."
So fängt es an, im Februar, und wird dann ein Jahr lang fortgesetzt, fast täglich, "nulla dies sine linea", denn anders wäre der Füller nicht wirklich einzuschreiben. Dass es sich um das Jahr 2006 handelt, wird bald klar, spätestens Anfang März, als von Tim Wieses missglückter Showeinlage als Torwart gegen Juventus Turin die Rede ist, die Werder Bremen das Weiterkommen in der Champions League kostete. Und später ist natürlich auch von dem sogenannten Sommermärchen die Rede, das - wieder gegen die Italiener! - im Juli ein abruptes Ende fand.
Vom Naheliegenden ist also zunächst die Rede, von dem etwa, was sich im Haus gegenüber abspielt (wir sind in Berlin), vom Windrad, das der Trinker auf seinem Balkon hat, von der Katze, die das Tintenfass auf dem Schreibtisch umgestoßen hat, vom dreijährigen Töchterchen und seiner Puppe Lisa, von der durch den Brockhaus langsam dämmernden Erkenntnis, dass es sich bei den Bäumen vorm Fenster nicht um Eukalyptusbäume, sondern um Silberweiden handelt.
Naheliegend ist aber immer das, was als Erstes einfällt, wenn der Füller in Betrieb genommen wird, denn in der Regel werden diese Notizen früh gemacht. Dementsprechend ist das Bild als Ganzes ähnlich disparat wie das alltägliche Leben. Peters hat es nicht darauf angelegt, ein kluges und gedankenreiches Tagebuch zu führen und sich in die Reihe der berühmten Diaristen einzureihen. Das schließt natürlich nicht aus, dass ihm ständig Klugheit und Gedankenreichtum unterlaufen und zuweilen auch ein so glänzend gelungener Sarkasmus, dass ich versucht wäre, die ganze Tagesnotiz zu zitieren, wofür hier aber der Platz fehlt. Da geht es um die Perser (Iraner), die bekanntlich schon immer böse waren und nun die Atombombe haben wollen, dabei verhält es sich doch so: "Als Erben der Römer steht den Amerikanern das meiste zu und eigentlich wären auch nur sie berechtigt, die Atombombe zu besitzen. Sie sind die Einzigen, die sie an Menschen ausprobiert haben, und wissen, wie man sie benutzt."
Kein Tagebuch also und auch kein Arbeitstagebuch, obwohl natürlich hier und da die aktuelle Arbeit durchscheint, denn der Leser begegnet etwa schon mehrmals Achim (diesmal nicht Tim) Wiese, den man drei Jahre nach diesen Aufzeichnungen als Gast von "Mitsukos Restaurant" in Peters' gleichnamigem Roman kennenlernen konnte. Und im Hintergrund vieler Notizen ist das eigentliche Feld erahnbar, auf dem sich die Arbeit dieses Autors abspielt. Das bisherige Werk von Peters bewegt sich ja bekanntlich zwischen der christlichen, islamischen und (zen-) buddhistischen Welt, und zwar, das sei ausdrücklich betont, ohne in Ethnokitsch oder in interkulturelle Einfühlungsekstasen abzurutschen. Dass dieser Autor eine explizit katholische Sozialisation am katholischen Niederrhein erfahren hat, merkt man auch bisweilen an Aufzeichnungen und Fragestellungen, die einem gut säkularisierten Kollegen gar nicht erst in den Sinn kämen.
In all dem Disparaten gibt es also durchaus ein paar durchgängige Kontexte, angefangen von der eigenen Familie (und Wohnung) über das Verhältnis zu den Eltern bis hin zu Adolph von Menzel, der plötzlich auftaucht, weil er im weiteren Sinn zur Ahnenreihe gehört, und dann nicht mehr von uns weicht. Man darf nicht vergessen, dass Peters sechs Jahre lang Malerei an der Kunstakademie in Karlsruhe studiert hat und dort Meisterschüler war, bevor er sich für die Literatur entschied.
Das dürfte auch das langjährige Verhältnis zu Matthias Beckmann geprägt haben, der den schönen Band mit den detailbesessenen Zeichnungen versehen hat, die man von ihm kennt. Illustrationen sollte man sie dennoch nicht nennen, eher Kommentare. Beckmann und Peters hatten sich 1996 als Stipendiaten im Künstlerdorf Schöppingen kennengelernt (und der Rezensent gesteht hier verschämt, dass er damals auch dabei war). Es ist nicht die erste Zusammenarbeit der beiden. Der Dialog, den sie miteinander führen, beruht auf einem sehr untergründigen Humor von beiden Seiten.
"In der Literatur", notiert Christoph Peters am 13. September, "gibt es keine Geheimnisse, nur das, was da steht. Aber was steht da?" Selbst nachlesen!
JOCHEN SCHIMMANG
Christoph Peters: "Einschreiben Aufzeichnen". Mit Zeichnungen von Matthias Beckmann.
Matthes & Seitz Verlag, Berlin 2013. 424 S., geb., 29,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main