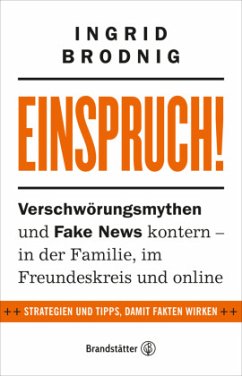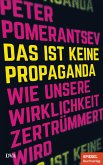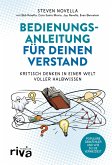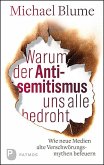Was tun, wenn Freunde, Verwandte oder Bekannte mit Aussagen kommen, die ins Reich der Verschwörungsmythen und Fake News gehören? Wie mit bizarren oder gar gefährlichen Theorien in sozialen Medien umgehen? In Diskussionen über das Coronavirus, die Klimakrise oder Migration verzweifeln wir über Spekulationen und Falschmeldungen. Das Gefühl der Überforderung wächst: Wieso glauben die mir nicht einmal dann, wenn ich dem Unsinn im WhatsApp-Chat mit Fakten kontern kann? Ingrid Brodnig zeigt, wie wir in hitzigen Debatten ruhig bleiben und unseren Standpunkt verdeutlichen. Wann ist Diskutieren überhaupt sinnvoll? Warum sind unseriöse Stimmen sichtbarer, und welche rhetorischen Tricks sollte man kennen? Welche Rolle spielen digitale Kanäle, und wie kommen wir gegen die Macht der Aufmerksamkeitsökonomie an? Dieses Buch liefert die Strategien für eine kluge Diskussionsführung und Tipps für Formulierungen, die auch in emotionalisierten Diskussionen wirken.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensent Gustav Seibt empfiehlt diesen praktischen Ratgeber von Ingrid Brodnig als Ergänzung zu Nicola Gass' theoretischer Untersuchung "Halbwahrheiten". Beide wissen um die "Gefühlskraft" von Halbwahrheiten und FakeNews, und deswegen findet Seibt ganz richtig, dass Brodnig nicht nur auf nüchterne Faktenchecks setzt, sondern auf Strategien, die auch rhetorisch-emotional den Verschwörungstheorien etwas entgegenhalten. Und schließlich bekommt der Rezensent von Brodnig einen guten Gradmesser an die Hand: Immer wenn eine Nachricht oder eine Geschichte ins Blut geht "wie Traubenzucker", sollte man ihr misstrauen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Eine in der Praxis absolut verwertbare Lektüre KirchenZeitung Diözese Linz 20220217