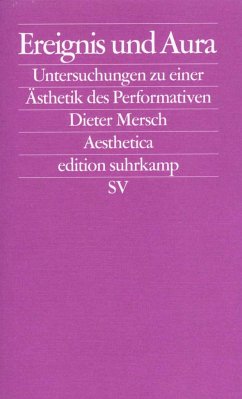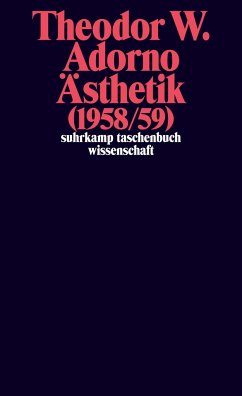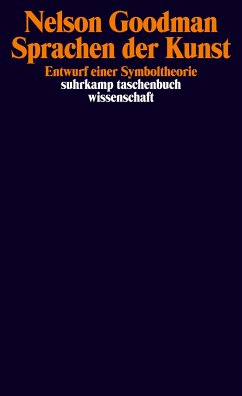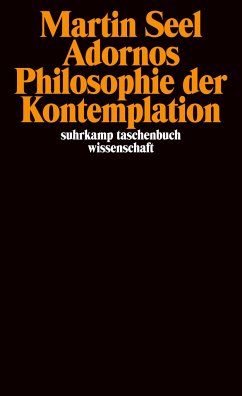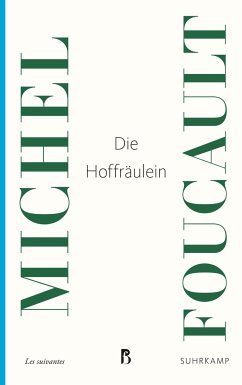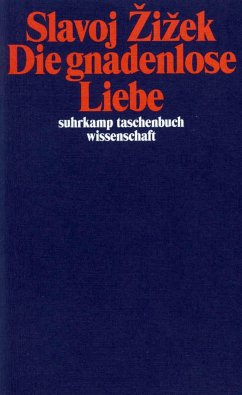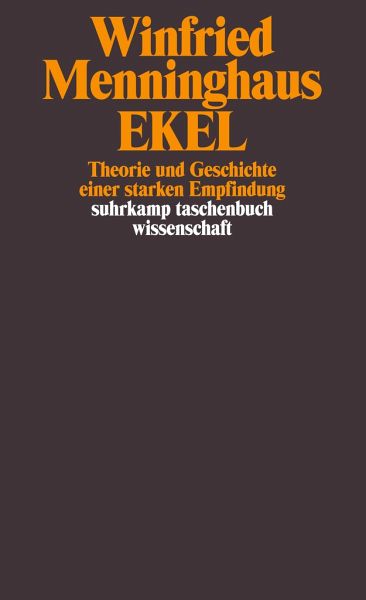
Ekel
Theorie und Geschichte einer starken Empfindung
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen
26,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
»Menninghaus' fulminantes Buch ist ein Lehrstück über die Zweischneidigkeit des Degoutanten, das als extreme Sensation den Affekthaushalt ebenso erschüttert wie stimuliert«, schrieb Ludger Heidbrink in der Zeit. Winfried Menninghaus bietet die erste umfassende Sichtung von Stellung und Funktion des Ekels in Philosophie, Ästhetik, Kunst, Psychoanalyse, Zivilisationstheorie und Alltagskultur von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Dabei zeigt sich, daß der Ekel als Chiffre der Bedrohung eine entscheidende Bedeutung innerhalb der Ästhetik von Kunst und Alltag hat.