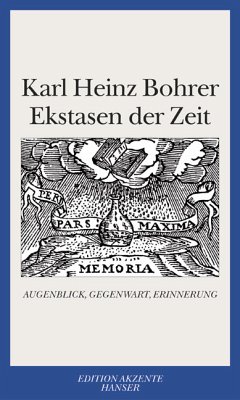In seinen viel gerühmten "Gadamer-Vorlesungen" in Heidelberg hat Karl Heinz Bohrer in einer weiten Perspektive unser Verhältnis zur Zeit und zur Geschichte analysiert. Seine Überlegungen zur Zukunft der Geisteswissenschaften, zur historischen und poetischen Trauer und zur Intensität der Jetzt-Erfahrung berühren zentrale Fragen der aktuellen Auseinandersetzung: bundesrepublikanisches Bewußtsein, kollektives Gedächtnis, Nation und Geschichte. Provakante Thesen, die ein nachhaltiges Echo gefunden haben.

Sollen die Herren Wehler und Habermas öfter in die Kirche gehen? Karl Heinz Bohrer mahnt alle
In seinen "Confessiones" hat Augustin gezeigt, daß die "Zeit nur in der Seele" sei. Karl Heinz Bohrer knüpft in sechs Vorlesungen über moderne Zeitkonzepte an den nordafrikanischen Kirchenvater an, um die Individualität je eigenen Zeiterlebens zu betonen. Sein Programm geschichtlicher Erinnerung lebt vom pathetisch dramatisierten Gegensatz zum "Gedächtnis"-Kult der Kulturwissenschaftler. Der kämpferische Geistesaristokrat will den halbgebildeten Kleinbürgern unter Deutschlands Historikern zeigen, wie die Geschichte der Nation eigentlich zu schreiben sei.
In scharfem Tone bezichtigt Bohrer die Gralshüter aufklärerischer Universalität, uns nationale Identität zu rauben. Er empfiehlt sich als der Therapeut, der die Deutschen durch Arbeit am Begriff der historischen Zeit von kollektiver Amnesie befreit. Auch feiert er den unbedingten Augenblick und rät zu einem posthistoristisch ästhetischen Verständnis der Geisteswissenschaften. Neues kann man nicht lesen. Wer Bohrers Arbeiten über "Das absolute Präsens", "Theorie der Trauer" und "Ästhetische Negativität" kennt, erleidet den Temporalmodus einer Langeweile, die sich bei Wiederlektüre von Altbekanntem einstellt. Hat es da ein Verlag allzu gut mit einem seiner altgedienten Autoren gemeint?
Gern kämpft Bohrer in den Schlachtordnungen von vorgestern. Man muß viel kulturpessimistisches Geraune über eine "kleinbürgerliche Medien- und Massenkultur" ertragen. In der ersten Vorlesung zieht der Intellektuelle gegen gesellschaftsstrukturalistische Historiker wie Hans-Ulrich Wehler und Hans Mommsen sowie ihren soziologischen Ratgeber M. Rainer Lepsius zu Felde. Zugleich führt er seinen Stellungskrieg gegen Karl Otto Apel und Jürgen Habermas fort. Die "gesellschaftskritische Intelligenz" habe die Deutschen geisteskrank gemacht. Das normale, gesunde "Fernverhältnis" zur Geschichte, das auch im fernen, fremden germanischen Mittelalter Eigenes entdeckt und durch die Rekonstruktion des "kulturellen Zusammenhangs" deutsche Identität stiftet, sei durch die "Emphatisierung einer historischen Nahbeziehung" abgelöst worden. Moralisierende "Geschichtspolitik" habe die deutsche Geschichte auf den Nationalsozialismus reduziert und Auschwitz zum einzig legitimen Erinnerungsort erhoben.
Deutsche Geschichte sei zur bloßen Vorgeschichte von 1933 mediatisiert und die Nation ihres geschichtlich gewachsenen Selbstbewußtseins beraubt worden. Bohrer beschreibt die "hochgradig ideologische Geschichtspädagogik" der Bielefelder Schule als vorsätzliche Gedächtniszerstörung: "Deutsche Geschichte wird, indem sie als Vorgeschichte funktionalisiert ist, gleichzeitig zur Nichtgeschichte annihiliert." In die "neurotisch wirren Zonen" des geschichtslosen Gedächtnisses seien dann Wahngebilde wie die "Europa-Utopie" und der "Verfassungspatriotismus" eingewandert. Ein integriertes Europa sei nur "wishful thinking aus dem Geiste des naiven Universalismus" von Frankfurter "abstrakten Moralisten".
Gegen Apel und Habermas insistiert Bohrer auf der Geschichtlichkeit der Vernunft. Er will transzendentale Reflexion auf eine Vernunft überhaupt lebensweltlich individualisieren, so daß der Geist sich in seiner Differenz zum Westen erneut als rein deutscher Geist erfaßt. Friedrich Schlegels "Entdeckung von Kontingenz" dient zum historiographischen Appell, die "lange, oft düstere, immer interessante, ja beeindruckende Geschichte der Deutschen" ohne "normative Kontrolle" zu "erinnern". Bohrers Nationalgeschichte soll wieder "affektive kollektive Besetzung" erlauben. Gegen das "Verschwinden jeder emotionellen Beziehung zur eigenen historischen Vergangenheit" klagt er starke patriotische Gefühle ein.
In der Tat ist in viele Geschichtsbilder der "Bonner Republik" ein unerträglicher Moralismus eingezeichnet. Aber das politpädagogische Oberlehrergehabe einzelner rechtfertigt es nicht, der deutschen Historikerzunft pauschal ein pathologisch verformtes "Kurzzeitgedächtnis" zu attestieren. Bohrers Polemik lebt von Wahrnehmungsresistenz. Ob er noch Verlagsprospekte liest? "Die drei Jahrhunderte der frühen Neuzeit zwischen Reformation und Französischer Revolution finden im deutschen Geschichtsdenken seit längerem fast nicht mehr statt. Das Mittelalter ist dem Publikum . . . vollends entrückt." Das kann nur sagen, wer seit Jahren keine Buchhandlung mehr betreten hat.
In immer neuen Scharmützeln zieht ein literarisch gebildeter lonely rider gegen die Übermacht der kulturwissenschaftlich Verblödenden zu Felde. Dem gängigen Memorialkultur-Jargon setzt Bohrer ein "produktives Gedächtnis" entgegen, das seine Zeichen aktiv hervorbringt, ohne in narzißtische Selbstbezüglichkeit zu verfallen. Zur poetischen Trauer fällt ihm die schöne "Reflexionsfigur des je schon Gewesenen" ein. Jede Gegenwart sei immer schon Vergangenheit. Aber schon bald erklingt wieder die Jeremiade über bundesdeutsche Amnesie, die wahre Trauerarbeit verhindere und NS-Memoria in "intellektuellen Kitsch" verwandele. Unvermittelt folgt die Einsicht, daß die "großen Trauerrituale in Europa ausschließlich von den Kirchen ausgerichtet" wurden. Will Bohrer sagen, daß sich Trauer kollektiv allein in den symbolischen Sprachen der Religion äußern kann? Sollen die Herren Habermas und Wehler nun öfter in die Kirche gehen? Bohrer bleibt vage, assoziativ und äußert sich zur Leistungskraft religiöser Symbolisierung geschichtlicher Schulderfahrung widersprüchlich. Er hofft auf den ästhetisch unbedingten Kairos und sieht doch selbst, daß seine Kunstreligion bloß ein schwacher Ersatz für christliche "Erlösung" ist. Rituelle Adorno-Anbetung ist eine Light-Religion.
Gleich anderen Diagnostikern moderner Entzweiung will Bohrer Sinnerfüllung zumindest momentan, in ekstatischer Intensität eines Augenblicks finden, der negativ Absolutes mitten im Endlichen aufscheinen läßt. Für diese unio mystica des immer schon vergangenen unbedingten Moments liest er Joyce und Proust, Basani und Virginia Woolf. Im "schweren Gelände des Adornoschen Idioms" soll Baudelaire verhindern, daß "Kulturfunktionäre" auf Lehrstühlen "das Nichtanschlußfähige" entschärfen, indem sie es kulturwissenschaftlich historisieren. Bohrer begeistert sich am eigenen Jargon der Uneigentlichkeit und berauscht sich am Meßwein von den Klostergütern Bataille, Derrida und Lyotard. Wer sein Hochamt des "poetischen Nihilismus" mitfeiert, muß jedoch eine hohe Kunstkirchensteuer entrichten. In den Weihesekunden des ästhetischen Augenblicks ist ironische Individualität erlaubt. Vor den Altären des Vaterlandes aber wird ironische Distanz als Sünde wider die Gemeinschaft der Nation verfolgt.
Hier klagt Bohrer ein "nationalgeschichtliches Pathos der deutschen Erinnerung" ein, das weder plurale Geschichtsbilder noch kritische Dekonstruktion erlaubt. Die Nation braucht den bindenden Mythos, und Bohrer will ihn herbeipredigen. Aber der pathetische Appell kann nicht verbergen, daß seine Nationalreligion der Kraft der "Erlösung" entbehrt. Selbst ein Adorno-Denkmal "Unter den Linden" könnte die starken nationalen Emotionen nicht bewirken, nach denen der Ritter der langen Erinnerung sich sehnt.
FRIEDRICH WILHELM GRAF
Karl Heinz Bohrer: "Ekstasen der Zeit". Augenblick, Gegenwart, Erinnerung. Hanser Verlag, München 2003. 136 S., br., 14,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Durchaus anerkennend nimmt Martin Bauer die Essays auf, in denen sich Karl Heinz Bohrer anschickt, eine "Kritik der gegenästhetischen Vernunft" zu entwerfen. Es gelte ihm, so der Rezensent in seiner recht akademischen Kritik, "die literarische Subjektivität vor ihrer Erlösung durch die verwandelnde Macht des Begriffes in Schutz zu nehmen". Dabei treibe Bohrer keine Zärtlichkeit für sensible Dichterseelen, sondern ein "akzentuiertes Wahrheitspathos", wie Bauer glaubt. Durchaus subtil findet unser Rezensent Bohrers Polemik, doch mag er den "himmelstürzenden Konsequenzen" nicht beipflichten, die sich aus der literarischen Darstellung absoluter Gegenwartslosigkeit ziehen ließen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH