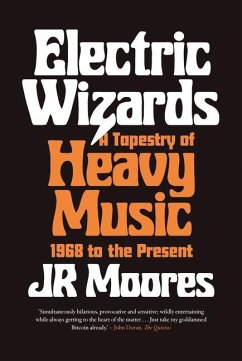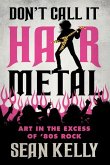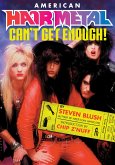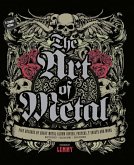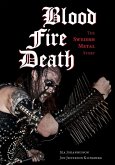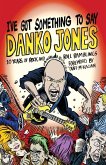Heute schon Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs gehört? J. R. Moores schreibt eine Geschichte der Heavy-Musik, die mit Metal allerdings nur am Rande zu tun hat.
Das Schönste an J. R. Moores' Parforceritt durch 53 Jahre Musikgeschichte ist die Anmaßung, alle Erwartungen konsequent zu ignorieren. Wer in "Electric Wizards. A Tapestry of Heavy Music" ein Werk über die Geschichte des Heavy Metal vermutet, sollte sich lieber ins Archiv des "Metal Hammer" begeben. Für alle anderen lohnt sich dennoch der Blick ins Buch.
Der Autor, ein britischer Musikjournalist, gibt sich erst gar nicht mit den Genregrößen wie Iron Maiden, Pantera, Sepultura oder Slayer ab, mit denen Heavy-Metal-Zeitschriften seit Jahrzehnten ihre Cover pflastern. Die Urväter des Genres, das trotz aller langen Haare sehr konservativ sein kann - Led Zeppelin oder, mehr noch, Judas Priest -, benennt er nur beiläufig. Bands neueren Datums wie Cradle of Filth oder Children of Bodom kommen gar nicht vor, ebenso wenig wie die Headliner des Progressive Metal, Dream Theater, Devin Townsend oder King's X.
Sympathischerweise nimmt Moores dieser Kritik gleich den Wind aus den Segeln: "This book was never intended to be a comprehensive chronicle of all heavy music", dieses Buch sollte nie eine umfassende Heavy-Chronik werden, heißt es im Vorwort. Das ist natürlich eine Untertreibung. Denn Moores schreibt kein lückenhaftes Buch über eines der langlebigsten Rock-Genres, er schreibt überhaupt kein Buch über Heavy Metal. Vielmehr spürt er der "Heavyness" nach, die der Autor als Kombination aus Kraft und Emotion in der Musik von Künstlern definiert, die mehr Wert auf Texte und originelle Sounds legen als auf Virtuosität oder technische Fähigkeiten.
Insofern ist das Buch eher ein subjektiver Streifzug voller Anekdoten durch die Geschichte härterer Gitarrenmusik, die sich aus den Underground-Clubs in den USA und Europa hoch in die Vorstandsetagen des kommerziellen Erfolges entwickelt hat - mit den Höhepunkten Stoner Rock und Grunge. Allesamt Sammelbezeichnungen für höchst unterschiedliche Stile, die die Liebe zur Gitarre teilen, ohne in Flitzefingersoloorgien auszuarten. Nach dem Motto: Melvins statt Joe Satriani, The Jesus Lizard statt Yngwie Malmsteen.
Moores entwickelt seine Tour d'Horizon entlang seiner Helden wie der aufgelösten Grunge-Band TAD oder der englischen Combo Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs. Gelegentlich nimmt er fragwürdige Abzweigungen, etwa zu den Nu-Metal-Rap-Rockern von Limp Bizkit oder den Hair-Metallern von Mötley Crue. Deren Song "Girls Girls Girls" dient Moores als besonderes Negativbeispiel oberflächlicher Posermucke.
Doch bevor der Autor weitere Einblicke in seine Sicht der Dinge erlaubt, schlägt er zwei Schlenker, von denen einer originell, der andere eigentlich vorhersehbar, in Moores plakativem Wunsch, das Vorhersehbare zu umgehen, wieder originell ist: Die Geschichte der "Heavyness" lässt er mit dem Jahr 1968 und dem Beatles-Lied "Helter Skelter" aus der Feder Paul McCartneys beginnen. Der Song mit den verzerrten Gitarrenwänden, den Rückkopplungen und dem Schreigesang gilt als Antwort auf The Who, die mit "I Can See for Miles" den ihrer Meinung nach härtesten Rocksong geschrieben haben.
Das konnte McCartney nicht auf sich sitzen lassen: Während Pete Townshend von The Who sich bis heute vor allem selbst feiert, feiert die Rock- und Alternative-Szene McCartney als Godfather ihrer Bewegung. In Seattle standen vor einigen Jahren die Nirvana-Überlebenden Dave Grohl, Krist Novoselic und Pat Smear mit dem Beatles-Überlebenden McCartney auf einer Bühne und spielten: "Helter Skelter".
Der zweite Schlenker führt zu Black Sabbath, der erwartbaren Band in einem Buch über Heavy Music, und zu ihrem Song "War Pigs" auf dem zweiten Studioalbum "Paranoid". Von dort aus zieht Moores eine direkte Linie zu Mike Patton, Jim Martin und den früheren Faith No More, die den Song auf "The Real Thing" gecovert haben, und die sich noch nie festlegen ließen, auch weil Patton gerne schon mal einen Song der Bee Gees trällert. Dass der Black-Sabbath-Gitarrist Tony Iommi nicht nur mit den Riffs, sondern auch dem gelegentlichen Drop-D-Tune, also dem Herunterstimmen der tiefen E-Seite um einen Ganzton, den Heavy-Sound mitgeprägt hat, ist hingegen keine Neuigkeit. Ebenso wenig die Erkenntnis, dass Black Sabbath die Geburtsstunde des Heavy Metal und all seiner Subgenres markiert.
Darüber hinaus gibt Moores nur wenige konkrete Hinweise, was das Besondere der "Heavyness" ausmacht. Besonders sticht die liebevolle Beschreibung der Melvins heraus, die mit ihrem Synkretismus aus Punk und Metal zu den Urvätern der Grunge-Bewegung gehören und auf Kurt Cobain von Nirvana ebenso wie auf Corey Taylor von Slipknot Einfluss ausgeübt haben. Zurecht schreibt Moores, die Entdeckung der Langsamkeit gehe auch auf das Konto der Melvins und ihres charismatischen Anführers Buzz Os- borne zurück. Sie erzielen durch die Reduktion des Tempos in Songs wie "Heavyness of the Load" einen besonderen Effekt: den der Schwergewichtigkeit, also der "Heavyness".
Natürlich hätte der Autor diesen Effekt auch an Type O Negative und anderen Bands vorführen können, aber die kommen gar nicht vor, zumal der Autor den düsteren Gothic-Vertretern ohnehin wenig Raum gibt. Verwunderlich ist auch, dass die kommerziellen Superstars des Heavy-Metal-Genres, Metallica, nur am Rande Erwähnung finden, dann allerdings am Beispiel ihrer Kollaboration mit Lou Reed auf dem Album "Lulu". Metallica-Fans des Frühwerks dürften mit dem schwer verdaulichen Album noch immer Schwierigkeiten haben. Der Klarheit der Definition von "Heavyness" hätte allerdings eher gedient, den Metallica-Song "Wherever I May Roam" zu besprechen, vereint er doch vieles, was Heavy-Musik ausmacht, vor allem die dynamische Schwere.
"Electric Wizards" hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. Moores sitzt dem Irrtum auf, die Originalität von Musik stehe in einem umgekehrten Verhältnis zum Können der Musiker. Der Autor ist ernsthaft der Meinung, Virtuosität sei eine Art Maskerade, um einen Mangel an Kreativität zu verschleiern. Das ist ein Glaubenssatz der Indie-Szene, die sich damit vom Stadionrock der Achtzigerjahre abgrenzen wollte - pure Di-stinktion, inhaltlich aber nicht überzeugend. Insofern ist das Buch auch ein Ärgernis, aber ein Ärgernis, das sich zu lesen lohnt. MARTIN BENNINGHOFF.
J. R. Moores: "Electric Wizards". A Tapestry of Heavy Music, 1968 to the Present.
Reaktion Books, London 2021. 480 S., Abb., geb., 25,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main