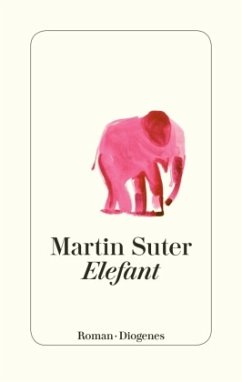Der kleine Elefant hat nämlich auch Beschützer. Da ist einmal Kaung, der burmesische Elefantenflüsterer, der die Geburt des Tieres begleitet hat. Er findet, etwas so Besonderes sei heilig und müsse vor dem profanen Zugriff versteckt werden. Aber auch der Obdachlose Schoch, der einmal bessere Tage gesehen hat, sieht auf einmal eine Aufgabe vor sich: Das seltsame Wesen würde zugrunde gehen, wenn er sich nicht seiner annimmt. Der kleine Elefant erlebt eine Odyssee, die in einem Zirkus beginnt, die Zürcher Obdachlosenszene aufmischt, den Frieden einer Villa auf dem Züriberg stört und schließlich in Myanmar endet, dort, wo man den Elefanten in besonderer Weise huldigt.
Er ist entzückend, ein Wunderwesen - und für den, der die genetische Zauberformel kennt, ein Vermögen wert: ein rosaroter Mini-Elefant, der in der Dunkelheit leuchtet. Plötzlich steht er da, in der Höhle des Obdachlosen Schoch, der dort seinen Schlafplatz hat und nun seinen Augen nicht traut.
Woher kommt dieses seltsame Geschöpf, und wie ist es entstanden? Das wissen nur wenige Personen, und sie verfolgen sehr unterschiedliche Interessen: Kaung, der burmesische Elefantenflüsterer, der die Geburt des Tiers begleitet hat, glaubt, es sei etwas Heiliges, das geschützt werden muss. Geschützt ja, aber als Patent, meint dagegen Genforscher Roux.
Die Schauplätze dieser atemberaubenden Intrige wechseln in rascher Folge von einem gentechnologischen Labor über einen Zirkus im Oberland zur städtischen Obdachlosenszene, von dort in den Schutz einer Villa auf dem Zürichberg und schließlich in ein Land in Südostasien, wo man den Elefanten auf besondere Weise huldigt.
Er ist entzückend, ein Wunderwesen - und für den, der die genetische Zauberformel kennt, ein Vermögen wert: ein rosaroter Mini-Elefant, der in der Dunkelheit leuchtet. Plötzlich steht er da, in der Höhle des Obdachlosen Schoch, der dort seinen Schlafplatz hat und nun seinen Augen nicht traut.
Woher kommt dieses seltsame Geschöpf, und wie ist es entstanden? Das wissen nur wenige Personen, und sie verfolgen sehr unterschiedliche Interessen: Kaung, der burmesische Elefantenflüsterer, der die Geburt des Tiers begleitet hat, glaubt, es sei etwas Heiliges, das geschützt werden muss. Geschützt ja, aber als Patent, meint dagegen Genforscher Roux.
Die Schauplätze dieser atemberaubenden Intrige wechseln in rascher Folge von einem gentechnologischen Labor über einen Zirkus im Oberland zur städtischen Obdachlosenszene, von dort in den Schutz einer Villa auf dem Zürichberg und schließlich in ein Land in Südostasien, wo man den Elefanten auf besondere Weise huldigt.

Alles ist erleuchtet: Martin Suters neuer Roman "Elefant"
Sie sind die "Glowing Animals", und sie leuchten im Dunkeln. Biolumineszenz heißt das Phänomen, das in der Natur vorkommt, Glühwürmchen kennt jeder, die Leuchtstoffe heißen Luziferine. Doch das Leuchten lässt sich auch durch genetische Manipulation herstellen, grün leuchtende Kaninchen und Kätzchen sind schon in der Welt. Warum also nicht ein rosa leuchtender Elefant? Die globale Genforschung arbeitet hart an den Eingriffen in die Schöpfung, es tun sich ungeahnte finanzielle Möglichkeiten auf: als Monstren der Neuzeit, als lebende Spielzeuge für Kinder, die schon alles haben.
An einem solchen Modell schuftet auch Dr. Roux seit Jahren in seinem supercleanen Labor in der sauberen Schweiz, unterstützt von einem stillen Teilhaber, einem Unternehmen in China, das weder Kosten noch illegale Mühen scheut. Als endlich ein Helfershelfer das genetische Material beibringt, das Roux braucht, beginnt das Experiment. Alles steht schon bereit. Dem Leib einer Elefantenkuh, die einem heruntergewirtschafteten Zirkus in der Schweiz gehört, der damit Geld beschafft, wird eine entsprechend genmanipulierte Blastozyste eingeführt - das Ziel: ein rosa leuchtender Elefant. Das Embryo nistet sich ein.
Menschen ohne Obdach neigen nicht selten zum übermäßigen Alkoholgenuss, weiße Mäuse sind da kein selten gesehenes Phänomen. Aber rosige Zwergelefanten in einer Höhle am unterspülten Uferweg der Limmat? "Seeing pink elephants" ist zwar im Englischen gebräuchlich für derartige Halluzinationen. Aber dass ein pinkfarbener Elefantenwinzling seinen Rüssel schwenkt, kleine Dungkugeln fallen lässt und Hunger hat, dann doch nicht. Da staunt auch Schoch, ein "Randständiger" in der reichen Stadt Zürich, der in einer Uferhöhle sein "Fluss-Bett" als Nachtlager gefunden hat. Schoch ist einer unter den Obdachlosen, die Regeln bürgerlichen Wohllebens hat er seit einem Jahrzehnt hinter sich gelassen, aber einige Rituale hält er für sich ein, er achtet auf seine Reinlichkeit.
Auch Schoch ist ein Trinker, aber er scheut den Untergang, und sein Mitgefühl ist noch nicht abgestorben. Er füttert das Tierchen in seiner Höhle mit Blättern und tränkt es. Doch das kleine Wunderwesen wird krank. ",Du stirbst mir nicht', murmelte er, ,du stirbst mir nicht.'" Er packt es in seine alte Sporttasche und bringt es in die "Gassenklinik" der Tierärztin Valerie Sommer, die sich dort in Gratissprechstunden um die Hunde der Obdachlosen kümmert, die "die Hündeler" heißen und auf ihre Tiere mehr Sorge verwenden als auf sich selbst.
Wie aber kam das grade mal dreißig Zentimeter hohe Elefäntchen in Schochs schwer zugänglichen Unterschlupf? Und was für ein Wesen ist das überhaupt, welche Mächte haben es hervorgebracht? Diese Geschichte erzählt Martin Suter in seinem neuen Buch "Elefant". Mit der Gentechnologie hat er sich einmal mehr ein Thema ausgesucht, das die Menschen bewegt und kontroverse Reaktionen hervorruft. Den einen ist sie ein expandierendes Forschungsfeld, das vielleicht ungeahnte Heilungschancen bereithält, den anderen eine rasend wachsende Industrie, die vor der Pervertierung der Evolution nicht haltmacht. Wieder hat sich Suter bei Experten genau informiert, aus der Hirnforschung, der Genetik und der Zoologie, speziell für den Umgang mit Elefanten. Über das Leben "auf der Gasse" hat er von zwei Kundigen eine Ahnung bekommen, denen er ebenfalls namentlich dankt.
In "Elefant" treibt Suter seinen lakonischen Stil auf die Spitze, in kurzen Kapiteln und in Orts- und Zeitwechseln. Es ist kein Thriller wie davor "Montecristo", wo er die Amalgamierung staatlicher und finanzwirtschaftlicher Interessen bis in feinste Verästelungen offenlegt (allerdings macht er sich den Spaß, die Bank aus "Montecristo", die GCBS, doch kurz zu streifen). Und es ist keine in die Metaphysik ausgreifende Parabel wie "Die Zeit, die Zeit" vor fünf Jahren. Es ist eine spannende Jagd, die ihre Leser vor sich hertreibt bis zum Schluss, mit der Kunst des suspense. Die Moral davon ist gewissermaßen selbst leuchtend, die Ordnung der Welt ist bedroht.
Mit der Geschichte von Sabu Barisha, wie die kleine Elefantenkuh schließlich heißen wird, hat Martin Suter ein veritables Märchen geschrieben. Es kämpfen die Guten gegen die Bösen, über Kontinente hinweg, und es gibt sogar am Ende eine Liebe zwischen zwei Menschen, die eigentlich unmöglich schien. Wie in den schönsten Märchen muss das "Und wenn sie nicht gestorben sind . . ." den Tod aushalten, die Trauer um Verlust. Der Roman endet erst in der nahen Zukunft. Es gibt dann ein Elefantencamp in Burma, ein Sanktuarium im doppelten Sinn: Schutz für hilfsbedürftige Tiere und heiliger Ort. Dort steht ein kleiner Tempel für einen winzigen rosa leuchtenden Elefanten.
ROSE-MARIA GROPP.
Martin Suter: "Elefant". Roman.
Diogenes Verlag, Zürich 2017. 352 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Roman Bucheli hat Martin Suter getroffen, um in einem ganzseitigen Porträt und mit einer gewissen Penetranz herauszufinden, wie der Schweizer Schriftsteller "so viel Erfolg mit so wenig Kunst" haben kann. Nach dem Text möchte man vermuten, dass es etwas mit Contenance zu tun hat. Von dem neuen Roman "Elefant" hält Bucheli zumindest im literarisches Sinne nicht viel: Es geht um Genmanipulation, und der Rezensent sieht in einem schlichten Setting eine Handvoll Bösewichte gegen eine Handvoll guter Menschen in Stellung gebracht und dazwischen einen kleinen rosa Elefanten. Allerdings billigt Bucheli dem Autor zu, sehr dynamisch zu erzählen, voller Tempo, Spannung und Cliffhanger. Außerdem schreibe er so sinnlich, dass man Elefantendung förmlich riechen könne. Handwerkliches Können, nicht Kunst ist für Suters Erfolg maßgeblich, ahnt Bucheli.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Martin Suter gilt als Meister einer eleganten Feder, die so fein geschliffen ist, dass man die Stiche oft erst hinterher spürt.«