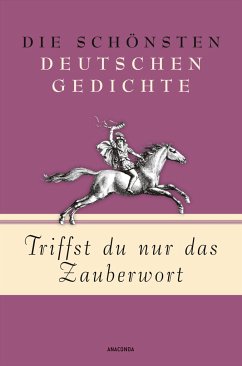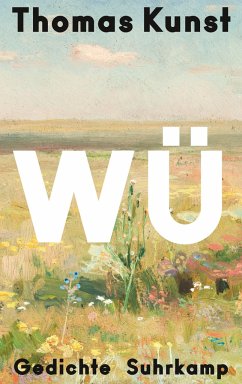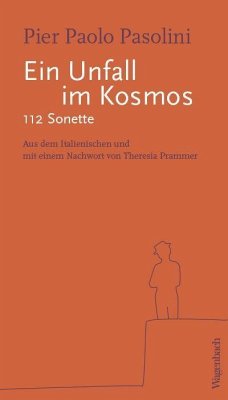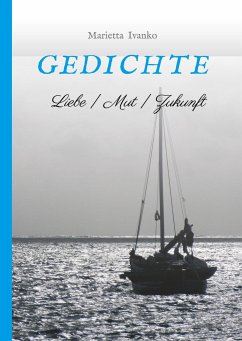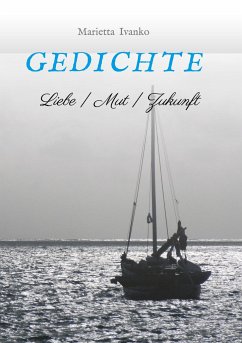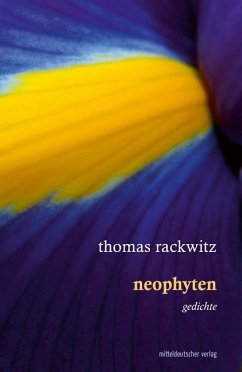Elemente, Sonette
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 3-5 Tagen
17,90 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Wasser, Feuer, Erde, Luft - die Urprinzipien der Welt. Vier Elemente, aus denen jedes Sein besteht. Franz Josef Czernin macht diese mythischen Urkategorien der Elemente nicht nur zum Thema seines Sonettenzyklus, sie prägen die Gedichte auch in ihrer Form. Die Sprache ist von Element-Metaphern wie "ganz Feuer und Flamme" oder "Du bist Luft für mich" durchsetzt und weist mit ihrer Bildhaftigkeit darauf hin, wie tief die Elemente in die Natur der Sprache reichen.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.