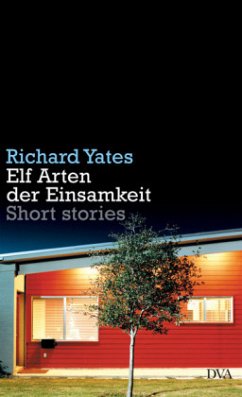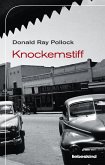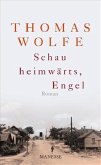Wie Ernest Hemingway prägte Richard Yates eine ganze Generation von Schriftstellern. Ob Angestellter in einem kleinen Büro in Manhattan, ob Feldwebel in Texas oder ob Tuberkulosepatient auf Long Island, Richard Yates' Figuren sind allesamt darum bemüht, ihr unglückliches Leben in den Griff zu bekommen. Sie hassen ihre Arbeit, trinken zuviel und träumen von besseren Zeiten. Sie schlingern zwar dem Untergang entgegen, aber sie weigern sich, ihre Illusionen aufzugeben.
Richard Yates entlarvt die Schattenseiten des amerikanischen Traums mit realistischer Schärfe. Zugleich zeichnet er seine Figuren mit tiefer Sympathie. Meisterhafte Short stories aus einer Welt, die ihre Ideale zu verlieren droht.
Richard Yates entlarvt die Schattenseiten des amerikanischen Traums mit realistischer Schärfe. Zugleich zeichnet er seine Figuren mit tiefer Sympathie. Meisterhafte Short stories aus einer Welt, die ihre Ideale zu verlieren droht.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
"Elf Arten der Hölle", so hätte man aus Sicht von Rezensent Edo Reents diese Stories auch überschreiben können. Ob aus den Geschichten über eine Ehe, das Angestelltendasein oder aus dem Klassenzimmer: Kalter Angstschweiß und Fatalismus strömt Reents aus Richard Yates' Geschichten entgegen. Der Rezensent ist beeindruckt von der "Klarheit des Stils", mit dem Yates das Unglück der kleinen Leute auch sprachlich auslotet. Ihre beklemmende Wirkung beziehen die Stories für ihn, weil ihm die Normalität der geschilderten Konflikte und Figuren signalisiert, dass Ähnliches jedem von uns passieren kann. Nicht nur der Röntgenblick, mit dem Yates seine Figuren"gleichsam aufs Skelett" zerlegt, lässt ihn für Reents zur Vaterfigur eines Raymond Carver und Richard Ford werden, zu einem Mitglied der Autorenfamilie, zu der Reents auch Hemingway und Scott Fitzgerald zählt. Deshalb findet er es verwunderlich, dass Yates hierzulande immer noch kaum bekannt ist. So preist er auch den Verlag für die Edition dieses Buches, dessen Original bereits 1962 erschienen ist.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Meisterhaft beschreibt Yates das wachsende Chaos im Leben seiner Charaktere und hält sensibel die Balance zwischen Sympathie und ironischer Distanz, Mitgefühl und harter Wirklichkeit." The New York Times

Die Würde der Niederlage: Richard Yates demontiert in seinen Stories den amerikanischen Traum / Von Edo Reents
Richard Yates hat es nicht leicht gehabt in seinem Leben, das sechsundsechzig Jahre währte. Der Krieg, berufliche Unsicherheiten, unglückliche Liebschaften, Scheidungen und Alkoholismus sind dabei noch die handelsüblichen Bestandteile einer Schriftstellerbiographie. Es gab Zeiten, da war sich der Erzähler nicht sicher, ob nicht er es gewesen sein könnte, der Präsident Kennedy erschossen hat, für dessen Bruder Robert er Reden schrieb; außerdem hatte er Angst, er könnte in einem Moment, den er nicht unter Kontrolle haben würde, seinen geliebten Töchtern Gewalt antun. Dazu kam es nie. Doch die Psychosen, unter denen er litt und gegen die er reichlich Pillen und Schnaps zu sich nahm, mündeten in einen Rest, den er wie ein Geist verlebte, stark rauchend bis zuletzt und sogar auch dann, wenn er an Sauerstoffflaschen angeschlossen war, weil seine früh von der Tuberkulose geschwächte Lunge den Dienst immer öfter versagte.
Wie konnte es sein, daß eine solche Existenz, die fast dostojewskisches Format hatte und uns seit der leider noch nicht übersetzten Biographie von Blake Bailey "A Tragic Honesty: The Life and Work of Richard Yates" zugänglich ist, so lupenreine Prosa hervorbrachte? Falls sich die Bedeutung eines Schriftstellers an der Klarheit seines Stils bemißt, darf man sagen, daß das Unglück, das Yates zwar nicht für sich gepachtet hatte, das er aber besonders tief empfand, ihn in einer Weise hellsichtig gemacht hat, die auch sprachlich Folgen hatte. Eine andere Frage ist, warum dieser Autor immer noch nicht ausführlicher gewürdigt wurde. Zwar wurde er als einer der wichtigsten Amerikaner des zwanzigsten Jahrhunderts anerkannt und auch längst als Vaterfigur für Raymond Carver und Richard Ford ausgemacht, blieb aber in seiner eigentlichen Bedeutung zumindest hierzulande nach wie vor kraß unterschätzt. Dies änderte sich auch nicht nennenswert, als Ende 2002 sein Roman "Revolutionary Road" auf deutsch erschien ("Zeiten des Aufruhrs") - vierzig Jahre nach der Originalausgabe.
Um so mehr ist die Deutsche Verlags-Anstalt dafür zu preisen, daß sie nun nachlegt mit den von 1962 datierenden Erzählungen "Elf Arten der Einsamkeit" ("Eleven Kinds of Loneliness"). Yates weiß, daß es so viele Arten von Einsamkeit gibt, wie es Menschen gibt - jeder kennt nur seine. Und doch zeichnet er Typen, exemplarische Menschen ihrer Zeit und ihres Milieus; den Lungenkranken beispielsweise, dessen Körper vom langen Liegen in der Klinik dermaßen eingefallen ist, daß seine Frau Trost sucht in den Armen eines Kräftigeren: "Ihre Hände strichen ihm über den massigen Rücken und krallten sich daran fest." Das wird, wie alles andere, einfach so erzählt, als etwas Verständliches, fast Zwangsläufiges. Die Patientenerzählung "Überhaupt keine Schmerzen" verrät schon im Titel jene prinzipielle Leere, aus der sich schlecht ein Vorwurf stricken läßt, deren Folgen aber traurig machen. Man lese, was die Eheleute sich noch zu sagen haben, dann weiß man, daß die Hölle zur Not auch ohne Hitze auskommt.
Elf Arten der Hölle - so hätte man die Sache auch überschreiben können. Es sind Ehehöllen, Angestelltenhöllen, Klassenzimmerhöllen, allgemein: Nachkriegshöllen. Yates erzählt ausschließlich von seiner Generation, von den einst Dreißigjährigen, die damals viel erwachsener waren und auch sein mußten als wir Heutigen; er gilt als Chronist der Fünfziger-Jahre-Mittelmäßigkeit, eines gerne in Vorstädten ansässigen Milieus, bei dem materielle Versorgung und die Träume von einem besseren Leben in einer Balance sind, die lähmend wirkt. Dies zeigt sich exemplarisch in einer der stärksten Geschichten: "Ein Masochist" erzählt von dem Bürohengst, der seine Arbeitszeit im wesentlichen damit verbringt, darauf zu warten, endlich gefeuert zu werden, und der noch "danke" sagt, als es soweit ist. Kalter Angstschweiß läuft diesem Jedermann dann trotzdem den Buckel hinunter, der seine Würde nur in der Niederlage findet. Glänzend schildert Yates die schulterklopfende Anteilnahme der Kollegen als etwas, das der Entlassene genießt wie ein Filmheld. Den Vorsatz, es der Familie zu verschweigen, bricht der Gedemütigte schon am ersten Abend.
Die gleiche Fatalität verströmt "Alles, alles Gute", die mitleidlose Chronik einer Eheschließung, die für keinen von beiden besonders günstige Aussichten bereithält: eine graue Büromaus, die sich daran gewöhnen muß zu gehorchen, und ein ehrgeiziger, robuster und doch leicht kränkbarer, also durchschnittlicher Angestellter, der den Junggesellenabschied in besserer Erinnerung behalten wird als den glücklichsten Tag im Leben.
Von Verlierertypen kann man da nicht mehr sprechen, dafür fehlt dem Personal die Fallhöhe. Die Leute sind, wie sie sind, und sie entwickeln sich nicht mehr. Man kann sie einteilen in solche, die das Talent haben, die Dinge in Gang zu bringen, ohne daß dies zu etwas führt, und solche, denen das Talent fehlt, etwas mit sich geschehen zu lassen. Yates ist vor allem an letzteren interessiert, die Passivität seiner Figuren schmerzt zuweilen. Merkwürdig berührt "Der BAR-Mann", die bittere Geschichte eines keineswegs haltlosen Veteranen, den das Gezanke seiner gebärunwilligen Frau in die Flucht treibt: "Und plötzlich sah sie so erbärmlich aus, daß er es nicht mehr ertrug. Er nahm seinen Mantel und drängte sich an ihr vorbei. ,Mach, was du willst', sagte er. ,Ich geh jetzt.' Und dann verließ er mit einem lauten Knallen der Tür die Wohnung." Die Wut über eine Ehehölle, die weder Sartre noch Loriot treffender gezeichnet hätten, entlädt sich in der Attacke des nicht mehr Zurechnungsfähigen auf einen des Kommunismus verdächtigten Gelehrten.
Dies ist eines der wenigen Zugeständnisse an den Zeitgeist, den Yates sonst heraushält aus seinen Geschichten. Mit großer Sorgfalt siedelt er sie an in einem Bereich zeitlos moderner Konflikte, um die er nicht viel Worte macht. Sie sind um so beklemmender, als ihre Normalität signalisiert, daß auch uns dergleichen jederzeit widerfahren kann. Er ist - und das wurde öfter mißverstanden - weniger der Autor der begrabenen Träume; er entlarvt nicht; er führt uns, ohne sehr ins Detail zu gehen, mit einem die Personen gleichsam aufs Skelett zerlegenden Röntgenblick, vor, wie es ist, wenn selbst bescheidene Ziele eine Nummer zu groß sind für uns.
Dies erfährt im Grunde jeder seiner Helden: der Redakteur einer Gewerkschaftszeitung, "der mit den Haien kämpft" (so der Titel) und dabei aus den Augen verliert, daß zum Mitleid auch Takt gehört; der snobistische, reiche Nichtstuer, der sich Sorgen um einen schwarzen, "wirklich guten Jazzpianisten" macht, die nicht seine sind; und die Lehrerinnen der einfühlsamen Schulgeschichten "Doktor Schleckermaul" und "Spaß mit Fremden", die nicht merken, wie sehr ihre Ungeschicklichkeit sie isoliert.
Am meisten aber ist Yates in seinem Element als writer's writer: "Baumeister" heißt die letzte, aber zentrale und mit Abstand längste dieser trostlosen Erzählungen, mit der er vermutlich am meisten von sich preisgegeben hat: von seinem nie befriedigten Ehrgeiz, im "New Yorker" zu veröffentlichen - akribisch verzeichnet der Biograph Bailey die Ablehnungsbescheide des hochnäsigen Magazins -; von seiner Selbstverachtung, die das Zusammenleben mit ihm schwerer gemacht haben dürfte als seine Sucht; und von seinem Traum, so zu schreiben wie Hemingway. Es ist die Geschichte eines would-be, des Möchtegernschriftstellers Bob, der sich von dem lächerlich und unglaublich komisch daherschwadronierenden Taxifahrer Bernie hereinlegen läßt und für diesen den gewinnbringenden Ghostwriter gibt. Es ist zugleich eine Baukastenanleitung fürs literarische Schreiben, das man entweder beherrscht oder nicht (Yates, der viele Schüler hatte, glaubte an die Lehr- und Lernbarkeit dieses Berufs): Man hebe eine Grube aus, errichte das Fundament, ziehe Mauern hoch, baue Fenster ein und einen Schornstein obendrauf. Das hier, wie meistens bei Yates, merkwürdig offene Ende rührt mit dem Eingeständnis, daß der Bau nichts taugt: "Und wo sind die Fenster? Wo kommt das Licht herein? Bernie, alter Freund, verzeih mir, aber darauf weiß ich keine Antwort. Ich bin nicht einmal sicher, daß dieses Haus überhaupt Fenster hat. Vielleicht muß das Licht, so gut es kann, durch die Spalten und Ritzen eindringen, die das mangelhafte Geschick der Baumeister übrigließ, und wenn es so ist, kannst du gewiß sein, daß sich deshalb niemand schlechter fühlt als ich." Die Sorge ist überflüssig. Was Richard Yates, dieser eigenwillige Baumeister, anfaßt, hat Türen und Fenster, Hand und Fuß. Er ist kein Hemingway, kein Fitzgerald, aber einer von deren Familie.
Richard Yates: "Elf Arten der Einsamkeit". Short Stories. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Anette Grube und Hans Wolf. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2006. 285 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"...ein großes literarisches Dokument aus dem Amerika der Nachkriegszeit." DeutschlandRadio Kultur