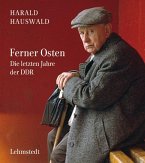Neun Jahre elfter September. 11. September, Datum des Jahrzehnts. Ein Bildtagebuch der letzten neun Jahre. Im Augenblick, Frühherbst 2010.
Wie sieht die Welt aus im Moment hier in Berlin. Wie war es in diesen Jahren. Was hat Rainald Goetz gesehen. Wie schaut es aus für ihn: das Gemachte, das, was da ist, das Kaputte, das Normale, der Alltag. Wie sieht er die Welt. Eben so, wie man hier sieht. Schau.
Jeder Satz sagt nein, und jedes Bild sagt ja. Wohnen, Wachen, Träume. Trümmer, abstrakt, Lichtvorfall. Was wird ausgeblendet, was wird übersehen, was wird nicht gezeigt, wovon abzusehen wäre. Eine Weltsicht, eine implizite Ethik. Ein Bildtagebuch von Rainald Goetz.
"Rainald Goetz ist zweifellos einer der ganz wenigen Autoren, die an einem vollkommen anderen Verständnis von Literatur festhalten, an einem Schreiben, das die Nahtstellen zwischen Erfahrung und Text ständig freilegt, das die Reflexion über das Schreiben immer schon enthält." -- Andreas Bernard, Süddeutsche Zeitung Wochenende
Wie sieht die Welt aus im Moment hier in Berlin. Wie war es in diesen Jahren. Was hat Rainald Goetz gesehen. Wie schaut es aus für ihn: das Gemachte, das, was da ist, das Kaputte, das Normale, der Alltag. Wie sieht er die Welt. Eben so, wie man hier sieht. Schau.
Jeder Satz sagt nein, und jedes Bild sagt ja. Wohnen, Wachen, Träume. Trümmer, abstrakt, Lichtvorfall. Was wird ausgeblendet, was wird übersehen, was wird nicht gezeigt, wovon abzusehen wäre. Eine Weltsicht, eine implizite Ethik. Ein Bildtagebuch von Rainald Goetz.
"Rainald Goetz ist zweifellos einer der ganz wenigen Autoren, die an einem vollkommen anderen Verständnis von Literatur festhalten, an einem Schreiben, das die Nahtstellen zwischen Erfahrung und Text ständig freilegt, das die Reflexion über das Schreiben immer schon enthält." -- Andreas Bernard, Süddeutsche Zeitung Wochenende

Was sagt die deutsche Literatur heute über unser Land? Manche Romane benehmen sich wie Sachbücher, mit anderen geht es mitten hinein ins blühende Brandenburg, in eine ostdeutsche Kindheit, westdeutsches Seniorenfernsehen und vor allem in die Wahrheit der Literatur.
Von Volker Weidermann
Plötzlich: eine schwarze Seite. Das ist so ein genialer Moment beim Lesen der neuen deutschen Bücher in diesem Herbst. Nur Bleistiftschraffur, daneben ein Totenkopf und ein Wort: "Memento!"
Unter der Schraffierung ahnt man weitere Buchstaben, aber der Autor wollte sie verschwinden lassen. Auf dieser Seite sollte Schweigen sein. Schwarze Striche. Tod. Es ist eine Seite aus den Kriegstagebüchern Ernst Jüngers, die in diesen Tagen erstmals publiziert werden: der Rohstoff seines Kriegsbuches "In Stahlgewittern", und diese schwarze Seite aus dem Tagebuch findet sich natürlich nicht in dem für die Öffentlichkeit umgearbeiteten, in Literatur transformierten Stahlgewitter-Buch. Es war der 28. Dezember 1915, ein Granateinschlag hatte dem niemals wortlosen, großen Selbststilisierer für einen Moment die Sprache geraubt. So sieht es zumindest aus.
Dieser schwarze Moment ist eindrucksvoller als jede detaillierte Schreckensbeschreibung. Bleistiftstriche. Leere. Soldat Jünger schweigt. Mühsam findet er zu den Worten zurück: "Als ich von diesem furchtbaren Schrecken noch zitternd, nach dem Unterstand von Pook und Plak zustrebte, platzte bei der Kirche ein ganz schweres Shrapnell, das einen Pionier bis zur Unkenntlichkeit auseinanderriß und eine Salve von Splittern durch die Weißbuchenhecke schleuderte, an der ich eben langging. Doch was war das gegen den eben gehabten Schrecken? Un jeu d'enfant!"
Ein Kinderspiel lässt sich beschreiben. Ein Lebensschock nicht. Gibt es eine Sprache für die Wirklichkeit? Ist das überhaupt die Aufgabe von Literatur? Ist die Literatur nicht gerade der Fluchtort vor dem Alltagsterror der Wirklichkeit? Wie wirklich soll es denn noch werden? Die Antwort ist: noch viel wirklicher. Die Literatur muss wirklicher als die Nachrichtenwirklichkeit sein, als die Vernunftwirklichkeit, die Durchschnittswirklichkeit. "Schreib Dich nackt!" Dies schrieb der amerikanische Essayist David Shields in seinem aufsehenerregenden Manifest "Reality Hunger", das vor einigen Monaten in Amerika herauskam. In 618 Punkten fordert er stakkatoartig Bücher für Menschen, die Fernsehen zu langsam finden. Schnellere Bücher, Bücher, die der Realität standhalten, die die Realität von heute in neuer Weise beschreiben.
Ein wenig wundert man sich über das große Pathos, mit dem die zusammengeraubten Thesen hier herausgebellt werden. Manifeste, wie etwa die der "Neuen Sachlichkeit", aus denen sich Shields freudig bedient, sind ja nun schon bald hundert Jahre alt. Aber es ist doch schön, zu sehen, wie wenig etwa Sätze Joseph Roths altern, diese hier: "Es handelt sich nicht mehr darum zu dichten. Das wichtigste ist das Beobachtete." Und dass Roth selbst sich in seinem späteren Leben und Schreiben von diesen Sätzen und der ganzen Sachlichkeit distanzierte, macht sie noch lange nicht falsch.
Im Gegenteil. Mehr denn je muss man sich in der Literatur unserer Zeit durch jede Menge Kunstwillen, Willen zur Stilisierung, Selbststilisierung und Kunstnebel hindurchkämpfen, bis man zu den Büchern gelangt, die etwas zu erzählen haben, die nicht Nebel werfen, um wichtig zu erscheinen, sondern einen radikalen Blick wagen - auf sich selbst und auf die Welt. Sprengstoffbücher! "Ich möchte mein Thema wie einen Bombengürtel tragen, mich mit ihm in die Luft jagen. Anders gelingt mein Roman zur Mutter nicht", heißt es im radikalsten, besten deutschen Roman dieses Herbstes, Peter Wawerzineks "Rabenliebe".
Die Welt der Politik hat ein Leben entzweigerissen, und da liegt es nun, das Leben, und muss gelebt werden. Die Geschichte einer Besessenheit, einer lebenslangen Suche: Es ist Peter Wawerzineks Lebensgeschichte. Als kleiner Junge hatte ihn seine Mutter allein in einer Wohnung in der DDR zurückgelassen, sie war in den Westen geflohen. Er wird gefunden, lebt im Kinderheim, dann bei wechselnden Adoptiveltern, die ihn wieder zurückgeben oder auch nicht. Ein hin und her gewirbeltes Leben, eine verrückte, traurige Geschichte. Beim Aufschreiben hätte man alles falsch machen können, und Wawerzinek hatte diese Geschichte auch schon einmal aufgeschrieben, damals völlig ohne Erfolg. Jetzt hat er die Sprache dafür gefunden. Eine Sprache, die von Rührseligkeit ebenso weit entfernt ist wie von scheinobjektiver Nachrichtensprache. Die Sprache seiner Wirklichkeit, gegen jede sogenannte Vernunft: "Die Vernunft lehnt sich gegen die Wirklichkeit auf. Eine schändliche Neigung ist die Vernunft. Kein größeres Laster gibt es in unserer Welt als den Hang zur Vernunft. Kein größeres Übel weiß ich." Mit diesem Sprengstoffgürtel gegen die Vernunft schreitet Wawerzinek durch seine Lebensgeschichte. Dinge, die unwahrscheinlich erscheinen, wie etwa, dass er in einer schwarzen Limousine aus seinem DDR-Kinderheim abgeholt wurde, bleiben wahr, weil er sich genau so erinnert.
Haut ab, ihr anderen, mit eurer angeblichen Geschichtswahrheit! Es kommt immer auf die Suggestivkraft der Sprache an, ob die Sprengkraft des Vernunftzerstörungsgürtels ausreicht, um eine eigene, neue Wirklichkeit zu erschaffen. Bei Wawerzinek reicht sie unbedingt. Erst lange nach dem Mauerfall reist er hinüber in den Westen, in den Teil des Landes, der ihm seine Mutter geraubt hat, unterwegs zu seiner Mutter, nach all den Jahren. Es ist die leiseste Stelle im Buch: "Mit meinem Wagen auf die Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland zufahrend, weiß ich nicht, warum mir die Tränen kommen, ich die Welt vor mir verschwommen sehe, welche unscheinbaren inneren Regungen mich während der Durchfahrt ergreifen."
Der Reporter Moritz von Uslar ist in der Gegenrichtung unterwegs, von West nach Ost. Und alles andere als leise. "Deutschboden" heißt sein Buch, im Untertitel "Eine teilnehmende Beobachtung". Er hat sich eine sonderbare Weltreise vorgenommen: Von Berlin-Mitte nach Brandenburg, vom irre schicken Champagner-Steak-Club-Restaurant der Lebens-Insider zur Kümmerling-Kneipe der Lebens-Outsider in einem Ort, den der Reporter Oberhavel nennt, in der Wüste Brandenburgs. Mit dem Auto ist es nur eine Stunde von hier nach dort. Doch die beiden Orte könnten einander nicht ferner sein. Uslar weiß, dass er nichts von dieser fernen, nahen Welt weiß, dass es ausschließlich Klischees sind, die er über die Bewohner dieses Landstrichs kennt: Nazis, Assis und Hartz IV, Hoffnungslosigkeit und Öde. So ist es doch, dieses ferne Brandenburg. Ist es so? Uslar fährt los, den Klischees hinterher.
Leider macht er es den Lesern zu Beginn schwer, ihm zu folgen, weil er selbst als ein Klischee durch sein Buch hindurchläuft. Die penetrante Selbstbezeichnung als "der Reporter" und "der Mann mit Hut" treibt den Leser nach relativ kurzer Zeit in den Wahnsinn. Kommen ihm die Ostdeutschen mit ihren gefürchteten Ost-Themen, kommentiert der Reporter sich so: "Als Reporter mit Hut musste ich mich auch um diese kümmern. Nützte nichts. Ich musste tapfer weiterfragen." Oha - wozu man heutzutage schon Tapferkeit benötigt! Dabei wird daraus im weiteren Verlauf noch ein herrliches Buch.
Weil Uslar eben wirklich total anderes findet und sieht als Armutsklischees, Hässlichkeit, Glatzköpfigkeit. Weil er Partys feiert, zum Boxen geht, trinkt, nachts mit 15o und ohne Licht über Landstraßen fährt, sich einlässt und sich beinahe, ja, verliebt, in die Jungs dort, aus Oberhavel. Und die Welt sieht plötzlich so überraschend anders aus, wie auf den Bildern Ostdeutschlands von Tobias Zielony, von denen Sie eins hier auf der Seite sehen. Irre schöne Momente gibt es in Uslars Buch, zum Beispiel beim Anblick eines Tattoos am Hals eines plötzlichen Freundes: Dort "konnte ich mehr Lebendigkeit, mehr Würde, Trotz und Kraft erkennen - ein großartiges Anherrschen der Welt und ihrer Grenzen - als in den Gesichtern der meisten erfolgreichen Großstadtmenschen, die ich kannte." Und wenn der Großgeldbesitzer staunend offenbar zum ersten Mal einem Menschen begegnet, der den ganzen Tag arbeitet und dabei weniger als den Hartz-IV-Satz verdient, da ist das eben keine blöde, langweilige Nachricht, sondern ein Erkenntnisblitz, der das Gesetz für einen bundesweiten Mindestlohn poetisch-ultimativ einfordert.
Immer weiter befreit sich Uslar von den Fesseln seiner Vorstellungen. Und auf der allerletzten Seite wird ihm sogar sein Klischee vom Kopf genommen.
"Kunst ist nicht Wahrheit", heißt Punkt 82 in "Reality Hunger"; "Kunst ist eine Lüge, die uns ermöglicht, die Wahrheit zu sehen." Ein Satz, der dem Tischler Rafael Horzon sicher ausgezeichnet gefallen hätte, der vor zwanzig Jahren von München nach Berlin-Mitte kam und entsetzt eine Stadt entdeckte, in der von jungen Menschen ausschließlich Kunst hergestellt wurde. Und in der die Wirklichkeit, Horzon nennt es Arbeit, den Menschen in ihrem Kunst-Delirium völlig aus den Augen geraten war. Er setzte dagegen auf Regalbau. Hat nun die Geschichte seines Lebens geschrieben und legt ausdrücklich Wert auf die Feststellung, dass "nichts an diesem Buch erfunden ist". Shields hat recht: So weit ist das Ansehen des Romans also gesunken, dass man sich als seriöser Sachbuchautor schon vor dem Romanverdacht schützen muss.
Oft fehlt es den Romanautoren einfach an Neugierde, oft an Bereitschaft für den neuen Blick. Oder an Wut. Wie sie zum Beispiel die ewig großartige achtundsiebzigjährige Gabriele Wohmann in ihren neuen Geschichten unter dem Titel "Wann kommt die Liebe" beweist. Ja, ihr Ton ist immer der gleiche, seit Jahrzehnten schon. Aber die Wut und Verstörung und Schonungslosigkeit ihrer Geschichten nehmen mit dem Alter zu. Existenzliteratur des höheren Alters: Eine Frau in einer katastrophalen Notsituation in einem Drogeriemarkt, zwei greise Schwestern planen eine innere Revolution gegen ein Fernsehprogramm, in dem sie nicht vorkommen. Ein Leben, das sie vergessen hat. Vor sich hin klagend, ermutigen sie sich: "Versuchs nicht mit Anpasserei und denke an das, was dir gefällt, frag deinen Kreislauf."
Radikalität am anderen Ende der Alterspyramide hat der junge Autor Marcel Maas geschrieben.
Fortsetzung auf Seite 35
Er ist dreiundzwanzig, kommt aus Oberhausen, hat an der Dichterschule von Hildesheim studiert, und seine Debüt-Erzählung "Play. Repeat.", die er selbst ein "Prosa-Set" nennt, liest sich überraschend unschreibschulig. Ja, auch hier wird die Wirklichkeit verschoben. Es geht um Tanz, um Samples, Drogen und Musik, es beginnt etwas irritierend, so, als wäre ein alter Herr in einen Jugendsprachtopf gefallen und würde nun wahllos mit angelsächsischen Musikwörtern wie "Fade out - Fade in" um sich werfen. "automatische feelings überall". Aber die Geschichte findet rasch zu sich, der Ton ist aggressiv, mal verloren, suchend. Vier Freunde verlieren den Boden unter den Füßen, verlieren jede Haftung an einen Lebensgrund. Es ist ein tanzender Abschied von einer Kinderwelt, Aufbruch in ein Neues: "Wir tanzen und sehen der Welt beim Wachsen zu." Und schreiben mit.
"Ein Hellboy muß umarmen", schreibt Peter Handke in seinem hyperdunklen Aufwachbuch "Ein Jahr aus der Nacht gesprochen", in dem er jeden müden Morgen einen plötzlichen neuen Satz notiert hat. Und an einem andren Tag: "Dem Text geht es nicht gut." Das hat sich der Weltnotierer Rainald Goetz vielleicht auch gedacht und hat seinen Verlag gebeten, einen schönen blauen Umschlag um das Fotoalbum mit den Bildern seiner Freunde zu binden. Das hat Suhrkamp gerne gemacht. Es wird viel getanzt in dem Buch "elfter september 2010". Der Reporter mit Hut kommt auch drin vor. Leider ohne Hut.
Und dann ist da noch dieses verrückt-schöne Debüt der dreiundzwanzigjährigen Mariam Kühsel-Hussaini mit dem Titel "Gott im Reiskorn". Die Autorin wurde in Kabul geboren, sie lebt heute in Berlin. Sie erzählt die Geschichte einer alten Kalligraphenfamilie aus Kabul, die ein junger deutscher Kunsthistoriker aus Berlin besucht. Er wird in die Zauberwelt der orientalischen Poesie eingeführt und erliegt dem Taumel dieser neuen Welt. Hussaini verfügt über eine ungeheure Sprachkraft. Sie verschwendet sie oft, verrutscht in Kitsch und übergroße Blumigkeit. Aber dass das Werk insgesamt glaubwürdig und stimmig und für Leser des Westens unbedingt neu erscheint, liegt an der genauen Kenntnis der Autorin von den Gegenständen, über die sie schreibt. Es ist ihre Familiengeschichte. Über den jungen Kunsthistoriker auf Besuch kann man lesen: "Jakob war sich nicht mehr ganz sicher, ob das, was er eben noch über die Wirklichkeit dachte, nicht doch längst schon wieder ein Schweben im Unmöglichen war."
Sie selbst scheint sich meist traumwandlerisch sicher in ihrem Schweben zwischen den Welten, zwischen den Wirklichkeiten und den Möglichkeiten. Am Ende ist es ein Abschied von einer untergehenden Welt und ein Klageruf: "Die Welt vergisst gern, und solch ein Vergessen ist der Tod. Welche Glocke soll man dann noch läuten, welche Banner noch schwenken, wenn alles abgerissen ist?"
So schön klang selten eine Welt aus. Und eine neue, eine andere Wirklichkeit scheint auf.
Mariam Kühsel-Hussaini: "Gott im Reiskorn", Berlin University Press, 315 Seiten, 22,90 Euro. Gabriele Wohmann: "Wann kommt die Liebe", Aufbau, 224 Seiten, 19,95 Euro. Peter Wawerzinek: "Rabenliebe", Galiani Berlin, 428 Seiten, 22,95 Euro. Marcel Maas: "Play. Repeat.", Frankfurter Verlagsanstalt, 124 Seiten, 17,90 Euro. Moritz von Uslar: "Deutschboden", Kiepenheuer & Witsch, 378 Seiten, 19,95 Euro. Peter Handke: "Ein Jahr aus der Nacht gesprochen", Jung und Jung, 216 Seiten, 20 Euro. Rainald Goetz: "elfter september 2010", Suhrkamp, 224 Seiten, 34,90 Euro. Rafael Horzon: "Das weisse Buch", Suhrkamp, 216 Seiten, 15 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main