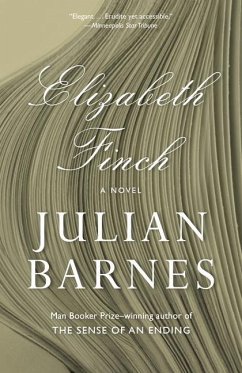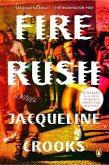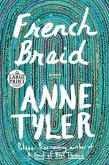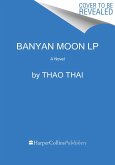From the bestselling, award-winning author of The Sense of an Ending, a magnetic tale that centers on the presence of a vivid and particular woman, whose loss becomes the occasion for a man's deeper examination of love, friendship, and biography. "I'll remember Elizabeth Finch when most other characters I've met this year have faded." -John Self, The Times This beautiful, spare novel of platonic unrequited love springs into being around the singular character of the stoic, exacting Professor Elizabeth Finch. Neil, the narrator, takes her class "Culture and Civilisation," taught not for undergraduates but for adults of all ages; we are drawn into his intellectual crush on this private, withholding, yet commanding woman. While other personal relationships and even his family drift from Neil's grasp, Elizabeth's application of her material to the matter of daily living remains important to him, even after her death, in a way that nothing else does. In Elizabeth Finch, we are treated to everything we cherish in Barnes: his eye for the unorthodox forms love can take between two people, a compelling swerve into nonfictional material (this time, through Neil's obsessive study of Julian the Apostate, following on notes Elizabeth left for him to discover after her death), and the forcefully moving undercurrent of history, and biography in particular, as nourishment and guide in our current lives.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Fast eine Liebesgeschichte und beinahe ein Epochenbild: Julian Barnes' Roman "Elizabeth Finch"
Ist dieses Buch wirklich ein Roman? Vielleicht kommt man ihm am ehesten nahe, wenn man es als eine Hommage betrachtet. Neil, ein Mann vorgerückten Alters - er hat graue Haare und zwei gescheiterte Ehen hinter sich -, erinnert sich an die Frau, bei der er vor Jahrzehnten - nach der ersten Ehe und einer missglückten Karriere als Schauspieler - ein Erwachsenenseminar über "Kultur und Zivilisation" belegt hat. Gleich auf der ersten Seite des Buchs hat sie ihren Auftritt. Sie tritt ans Pult, kündigt den Zuhörern an, sie werde sie "nicht mit Fakten vollstopfen wie eine Gans mit Mais", erwarte aber "Rigorosität" und nennt ihren Namen: Elizabeth Finch.
Dann folgt, was in einem Theaterstück als längere Regieanweisung gelten könnte. Mrs. Finch trägt feste Halbschuhe zu gestreiften Seidenblusen und knielangen Röcken, "im Sommer mit Kellerfalte, gewöhnlich marineblau, im Winter Tweed". Sie raucht. Sie hat Migräne. Ihre Sprache ist förmlich, ihr Satzbau grammatisch perfekt. Und - hier geht die Beschreibung in Handlung über - sie liebt es, Mythen zu dekonstruieren. Religiöse Mythen, Nationalmythen, Mythen des Alltags. Die elftausend Jungfrauen der heiligen Ursula? Es waren wohl nur elf. Die historische Menschheitsmission der Briten? In Amerika hielten sie länger Sklaven als die Amerikaner selbst. Am heftigsten hadert Elizabeth Finch mit der Sexualmoral des Christentums. "Monotheismus, Monogamie, Monotonie" bilden für sie die unheilige Trias der Lebensfeindlichkeit.
Die meisten Seminarteilnehmer sind von Elizabeth Finchs Unterricht eher moderat begeistert. Anders Neil: Er bleibt seiner Dozentin auch nach dem Ende des Zweitstudiums treu. Jedes Jahr trifft er sich zwei-, dreimal mit ihr in einem Restaurant, und sie reden über die Dinge des Lebens. Irgendwann muss Mrs. Finch die Treffen aus Krankheitsgründen absagen. Kurz darauf ist sie tot. Nach ihrer Beerdigung erfährt Neil, dass er ihre Papiere und ihre Bibliothek geerbt hat, und lernt ihren Bruder Christopher kennen, einen rundlichen weißhaarigen Mann, der ebenso durchschnittlich ist wie er selbst. Dann liest er die Notizen der Verstorbenen.
Inzwischen sind fast hundert Seiten vergangen, und man rätselt noch immer, worauf Julian Barnes mit dieser Geschichte hinauswill. In "Der Mann im roten Rock", dem Buch, das vor "Elizabeth Finch" erschienen ist, hat Barnes eine historische Figur, den französischen Frauenarzt Samuel Pozzi, dazu benutzt, mit eleganter Leichtigkeit das Porträt eines Zeitalters zu skizzieren. Davor hat er in "Die einzige Geschichte" ebenso virtuos die Liebesbeziehung zwischen einem jüngeren Mann und einer älteren Frau geschildert. "Elizabeth Finch" enthält Elemente aus beiden Büchern, ohne sie erzählerisch zwingend zu verbinden. Der frisch geschiedene Neil schwärmt, wie seine Freundin Anna rasch errät, nicht nur rein intellektuell für seine Geschichtslehrerin, aber eine Beziehung entsteht dennoch nicht daraus. Dafür ergibt sich aus den Aufzeichnungen, die Elizabeth Finch hinterlassen hat, ein Schreibprojekt, aus dem durchaus ein Epochenbild aus weit entfernten Zeiten hätte werden können. Doch bei ihrem Schüler Neil reicht es nur zu einem Essay.
Der füllt den Mittelteil des Buches. Es geht um Julian Apostata, den letzten heidnischen Kaiser des Römischen Reiches, und wenn man weiß, dass die frühen Christen in dem Toleranzpolitiker Julian den gefährlichsten Feind ihres Glaubens sahen, ist man schon mitten in der Gedankenwelt von Elizabeth Finch. Der Kaiser, der im Jahr 363 auf einem Feldzug gegen die Perser starb, wollte die alten lokalen Kulte in ein universales synkretistisches Glaubenssystem einbinden und so den Wahrheitsanspruch des Christentums aus dem Feld schlagen. Montaigne, Voltaire, Gibbon und Ibsen haben Julian gepriesen, Swinburne hat ihm ein berühmtes Klagegedicht gewidmet, und selbst Hitler bramarbasierte in seinem Hauptquartier über den Apostaten, dessen antike Weisheit man "in Millionen verbreiten" müsse.
Dies alles und viele weitere Lese- und Gedankenfrüchte hält Barnes' Erzähler auf knapp sechzig Seiten fest. Das Problem ist, dass in dieser Zeit die Geschichte von Neil und Elizabeth Finch gleichsam stillsteht. Als sie im dritten Teil des Buches wieder einsetzt, wirkt sie wie ein Nachtrag zu dem vollendeten Liebeswerk des Julian-Aufsatzes. Noch einmal erhebt sich ein Hauch erzählerischer Spannung, als Neil zu Anna reist, die inzwischen in einer holländischen Kleinstadt lebt, um Erinnerungen an das Seminar auszutauschen und womöglich alte Leidenschaften aufzuwärmen. Aber aus der Asche des Lebens steigt keine Glut mehr auf, und auch die Spur eines Liebhabers, mit dem Christopher Finch seine Schwester einmal am Bahnhof gesehen haben will, endet im Nichts. Zuletzt erfahren wir noch, dass Elizabeth einmal Opfer einer Pressekampagne wurde, nachdem sie in einem öffentlichen Vortrag heidnische und christliche Körpervorstellungen miteinander verglichen hatte.
Das ist so unglaubwürdig, dass es schon fast wieder Stoff für eine eigene Erzählung böte. Vor allem aber zeigt es, wie verzweifelt sich der Autor Barnes darum bemüht, seine Heldin für den Leser interessant zu machen. Doch es gelingt nicht. Elizabeth Finch ist eben kein Flaubert, und der brave Neil ist mindestens zwei Nummern kleiner als der Landarzt Geoffrey Braithwaite aus Julian Barnes' berühmtestem Roman.
Am Ende seines Julian-Essays gesteht der Erzähler ein, er sei in den Romanen von Michel Butor und Gore Vidal über den spätrömischen Kaiser leider nicht weit gekommen. Im Fall von Vidals "Julian" muss man diese Lesefaulheit bedauern. Denn bei dem Amerikaner, der sein 1962 erschienenes Geschichtspanorama als Briefwechsel zwischen dem syrischen Rhetor Libanios und dem athenischen Philosophen Priskos angelegt hat, hätten Neil und sein Autor erfahren können, wie ein moderner historischer Roman aussehen kann. Es ist das Buch, das "Elizabeth Finch" nicht geworden ist. ANDREAS KILB
Julian Barnes: "Elizabeth Finch". Roman.
Aus dem Englischen von Gertraude Krueger. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2022. 240 S., geb., 24,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
[Barnes] is always clever, often original and unusually funny... Elizabeth Finch...offers plenty to chew on...with barely a sentence in it that doesn't have some nutritional value. John Self The Times