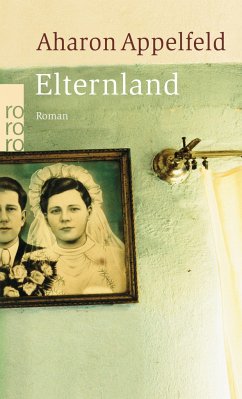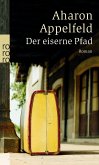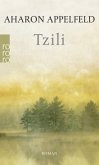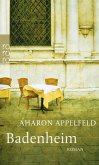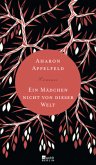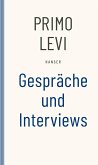'Appelfeld legt einmal mehr ein Meisterwerk vor' (NZZ)
«Appelfeld legt einmal mehr ein Meisterwerk vor.» (NZZ).
Nach Jahren des Zögerns entschließt sich Jakob Fein, aus Israel in das Land seiner Väter zu reisen: in jenes polnische Dorf, in dem seine Eltern den Holocaust überlebt haben. Auf ihren Spuren durch-streift er die Landschaft und lernt die Menschen kennen. Zufällig trifft er auf Magda, die sich an seine Eltern noch erinnern kann. Die Erzählungen der katholischen Bäuerin führen ihn zurück in die Vergangenheit. Die beiden verlieben sich ineinander. Doch je länger Jakob im Dorf bleibt, desto stärker muss er erfahren, dass die alten Vorurteile noch lebendig sind. Schmerzhaft beginnt er, nun auch die Geschichte seiner Eltern besser zu verstehen.
«Aharon Appelfeld ist ein wichtiger Zeuge des vergangenen Jahrhunderts. Er zählt zu den großen jüdischen Erzählern Osteuropas.» (IMRE KERTÉSZ)
«Appelfeld legt einmal mehr ein Meisterwerk vor.» (NZZ).
Nach Jahren des Zögerns entschließt sich Jakob Fein, aus Israel in das Land seiner Väter zu reisen: in jenes polnische Dorf, in dem seine Eltern den Holocaust überlebt haben. Auf ihren Spuren durch-streift er die Landschaft und lernt die Menschen kennen. Zufällig trifft er auf Magda, die sich an seine Eltern noch erinnern kann. Die Erzählungen der katholischen Bäuerin führen ihn zurück in die Vergangenheit. Die beiden verlieben sich ineinander. Doch je länger Jakob im Dorf bleibt, desto stärker muss er erfahren, dass die alten Vorurteile noch lebendig sind. Schmerzhaft beginnt er, nun auch die Geschichte seiner Eltern besser zu verstehen.
«Aharon Appelfeld ist ein wichtiger Zeuge des vergangenen Jahrhunderts. Er zählt zu den großen jüdischen Erzählern Osteuropas.» (IMRE KERTÉSZ)

Trümmerfeld: Aharon Appelfeld reist ins Land seiner Väter
Schidowze, das Dorf in Aharon Appelfelds Roman "Elternland", ist fünfzig Kilometer von Krakau entfernt. Es liegt an dem Fluss Schrinez, an dessen Ufer die Juden gebetet haben, die dort seit Jahrhunderten zu Hause waren. Vierzig waren es insgesamt. Sie sind fast alle ermordet worden; Frauen und Kinder verbrannten in der Synagoge, die Männer wurden im Wald erschossen, nachdem sie selbst ihr Grab geschaufelt hatten.
Was bringt einen Israeli, den Sohn von Überlebenden, dazu, in die Heimat seiner Vorfahren zu reisen, von der ihm seine Eltern kaum etwas erzählt haben, weil sie ihn mit ihren Erinnerungen nicht belasten wollten? "Eine Laune des Herzens", erklärt Jakob seiner Frau und den beiden erwachsenen Töchtern in Tel Aviv. Jakob ist ein erfolgreicher Geschäftsmann und israelischer Offizier, stolz auf sein Land und dessen Wehrkraft. Als er sich dem abgelegenen polnisch-ukrainischen Dorf nähert, fest entschlossen herauszufinden, was dort war und heute noch ist, hat er Glück; der Hof, in dem er anklopft und um Quartier bittet, gehört Magda, die seine Großeltern verehrt hat. Die Wochen mit Magda werden "die hellste Zeit seines Lebens".
Doch im Dorf bleibt er der Fremde. Will er wirklich nur unter den Bäumen am Schrinez träumen und Bücher lesen, die Primo Levi oder andere Schicksalsgefährten geschrieben haben? Er ist den trinkenden Männern im Gasthaus unheimlich: der erste Jude, der zurückkommt und seinen Besitz zurückfordert, so fürchten sie. Seine Mutter hatte ihn gewarnt: "In Schidowze sind nur noch die, die sich über unser Unglück gefreut haben." Das Haus des Großvaters, das einzige stattliche am Platz, gehört einem Kommunisten. Die Grabsteine der Vorfahren liegen als Pflaster zertrümmert vor dem Rathaus. Die Juden sind ermordet worden, aber Hass, Neid und die alten Vorurteile ihnen gegenüber sind noch lebendig.
Ohne die Juden sei das Dorf öde geworden, sagt die hundert Jahre alte Wanda; sie seien sparsam, ja geizig, vor allem aber klug gewesen. Sie hätten nicht getrunken, ihre Frauen nicht geschlagen, es zu Wohlstand gebracht und an ihrem Glauben festgehalten. Ein Jude ohne Glauben sei sehr anfällig. Wanda erinnert sich noch an Jakobs weisen Urgroßvater Itsche-Meir, der "mit den Engeln verkehrte" und allen "den Weg wies, Juden wie Nichtjuden".
Aharon Appelfelds autobiographische "Geschichte eines Lebens" waren die bruchstückhaften Erinnerungen eines Mannes, der als siebenjähriges Kind dem Morden entflohen ist und während des Krieges in Wäldern und entlegenen Gehöften der Karpaten, zuletzt als Küchenjunge der Roten Armee, überlebt hat. Als er 1946 nach Palästina einwanderte, musste er erst lesen und schreiben lernen, seine Sprache hatte er nahezu verloren. Seine Mutter hatte Deutsch, die Sprache der Mörder, mit ihm gesprochen. "Elternland", ebenfalls hervorragend aus dem Hebräischen übersetzt von Anne Birkenhauer, lässt sich als Fortsetzung der "Geschichte eines Lebens" lesen; vor allem aber als Versuch, Vergangenheit und Gegenwart miteinander zu verbinden. Die Liebesgeschichte mit Magda mag allzu romanhaft sein. Für Jakob ist diese Frau "das Tor zu Erinnerung", sie hat ihm "seine Kindheit wiedergegeben". Sie ist für ihn aber auch die Zuflucht, wo er Trost findet, wenn ihn die Erinnerung verzweifeln lässt. Jakob kehrt zwar nicht, wie er es beabsichtigt hatte, mit den Grabsteinen seiner Vorfahren nach Tel Aviv zurück, er hat aber für das Gedenken eine Sprache gefunden.
MARIA FRISÉ
Aharon Appelfeld: "Elternland". Roman. Aus dem Hebräischen übersetzt von Anne Birkenhauer. Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2007. 254 S., geb., 17,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Für Rezensentin Maria Frise liest sich Aharon Appelfelds Roman "Elternland" nicht nur wie die Fortführung seiner autobiografischen "Geschichte eines Lebens", sondern er erscheint ihr auch als ein Versuch Appelfelds, eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart herzustellen. In "Elternland" erzählt Appelfeld von einem erfolgreichen israelischen Geschäftsmann, der in das polnisch-ukrainische Dorf seiner Vorfahren reist. Fast alle Juden dort waren ermordet worden, referiert die Rezensentin, nur wenige konnten fliehen. Hier stößt er auf die alten Hassgefühle, Vorurteile, Neid, Stolz. Doch er trifft auch Menschen, die seine Großeltern noch gekannt haben, und er verliebt sich in die Magda, erklärt die Rezensentin. Wenn ihr die Liebesbeziehung auch ein wenig zu "romanhaft" scheint, zeigt sie sich insgesamt sehr eingenommen und lobt auch die Übersetzung aus dem Hebräischen von Anne Birkenhauer als vorzüglich.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
In Aharon Appelfelds Werk leben der Geist und die Sprache eines Joseph Roth fort. Die Welt