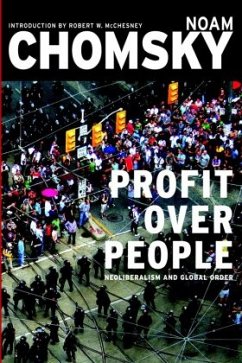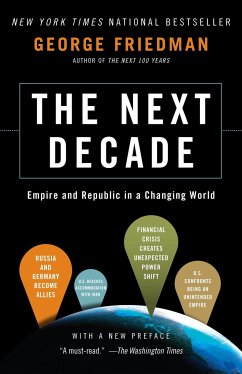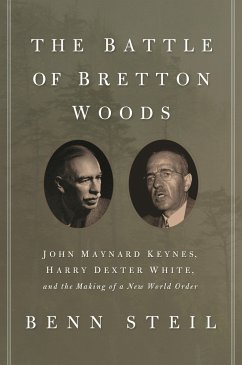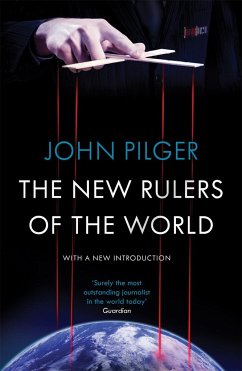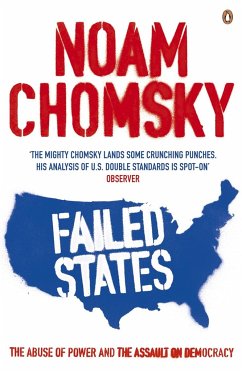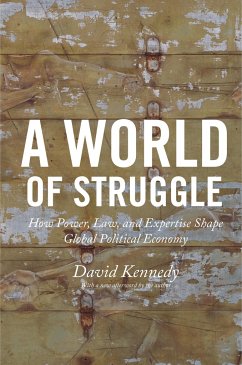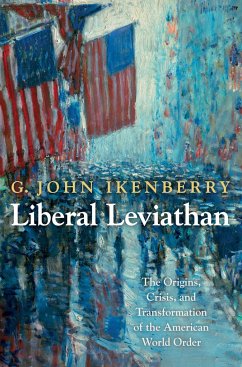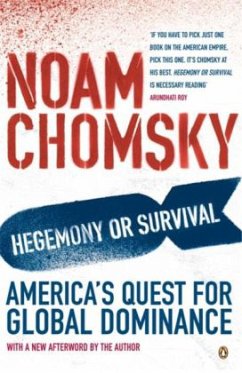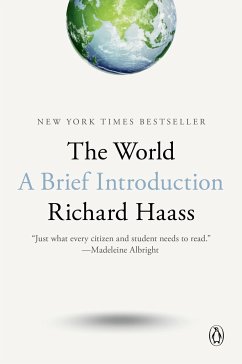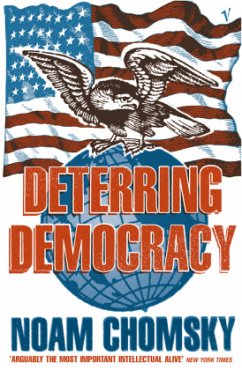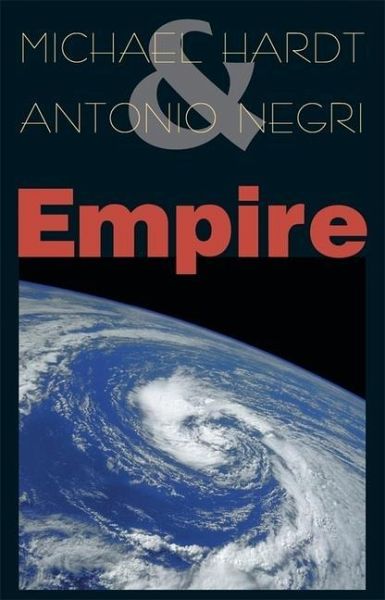
Empire
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
37,99 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
19 °P sammeln!
Empire, as Hardt and Negri demonstrate, is the new political order of globalization. Their book shows how this emerging structure is fundamentally different from the imperialism of European dominance and capitalist expansion in previous eras. Rather, todayâ s Empire draws on the hybrid identities and expanding frontiers of U.S. constitutionalism.