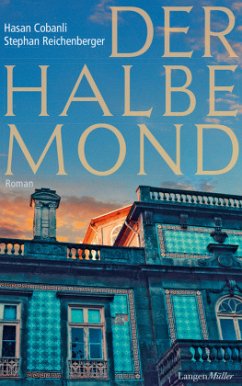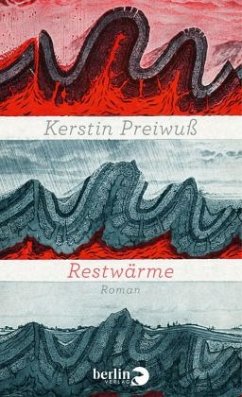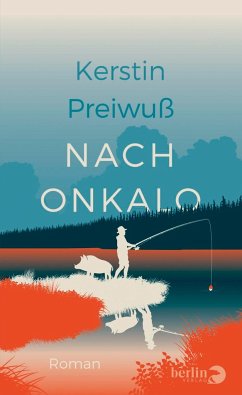Nicht lieferbar
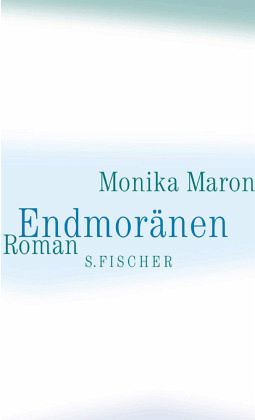
Endmoränen
Roman
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
Das Ende des Sommers, lange als Zumutung empfunden, erlebt Johanna seit einigen Jahren als Erleichterung. Die Hoffnung, mit der Zeitenwende das wirkliche Leben erst zu beginnen, ist dem Gefühl gewichen, nichts zu können, was die veränderte Welt braucht. Früher hat sie geheime Botschaften in ihren Vor- und Nachworten und in überliefernswerten Biografien versteckt, eine plötzlich überflüssige Fähigkeit, wie auch die weltabgewandte Charakterfestigkeit von Achim, ihrem Mann, eine überflüssige Tugend geworden ist. Auf dem Land, in einer nordöstlichen Endmoränenlandschaft, versucht sie,...
Das Ende des Sommers, lange als Zumutung empfunden, erlebt Johanna seit einigen Jahren als Erleichterung. Die Hoffnung, mit der Zeitenwende das wirkliche Leben erst zu beginnen, ist dem Gefühl gewichen, nichts zu können, was die veränderte Welt braucht. Früher hat sie geheime Botschaften in ihren Vor- und Nachworten und in überliefernswerten Biografien versteckt, eine plötzlich überflüssige Fähigkeit, wie auch die weltabgewandte Charakterfestigkeit von Achim, ihrem Mann, eine überflüssige Tugend geworden ist. Auf dem Land, in einer nordöstlichen Endmoränenlandschaft, versucht sie, gleichsam in einem Panoramablick, ihren biografischen Standort zu bestimmen, rückblickend, vergleichend und ratlos, was die vor ihr liegende Zeit angeht.
Johannas entschlossene und lebenskluge Freundin Elli benutzt das Wort Glück seit langem nur in seinen trivialen Zusammenhängen. Die erfolgreiche Malerin und Erbin eines Verwalterhauses Karoline Winter, vor jeder Flugreise in Todesangst, verzweifelt am Verfassen ihres Testaments, weil sie keine Erben hat. Christian, der alte Freund aus München, Lektor in einem Wissenschaftsverlag, erlebt den Sturz in die Bedeutungslosigkeit. Die Lebensentwürfe aller scheinen erschöpft, und die Zeit vor ihnen ist noch lang.
Johannas entschlossene und lebenskluge Freundin Elli benutzt das Wort Glück seit langem nur in seinen trivialen Zusammenhängen. Die erfolgreiche Malerin und Erbin eines Verwalterhauses Karoline Winter, vor jeder Flugreise in Todesangst, verzweifelt am Verfassen ihres Testaments, weil sie keine Erben hat. Christian, der alte Freund aus München, Lektor in einem Wissenschaftsverlag, erlebt den Sturz in die Bedeutungslosigkeit. Die Lebensentwürfe aller scheinen erschöpft, und die Zeit vor ihnen ist noch lang.