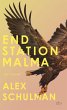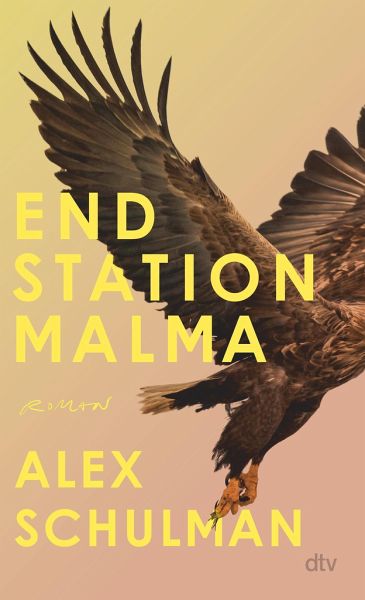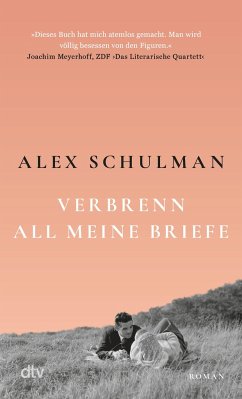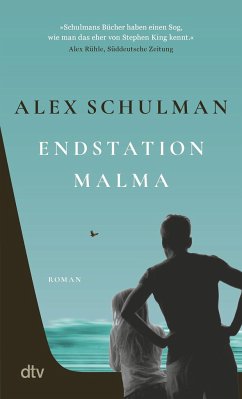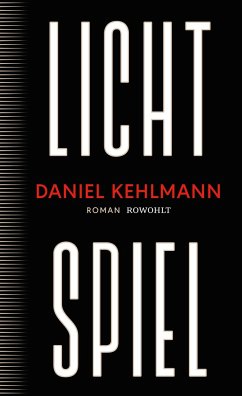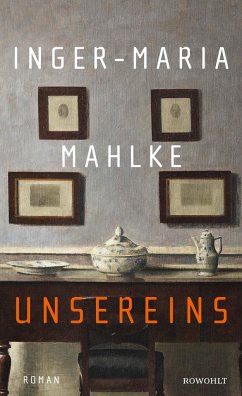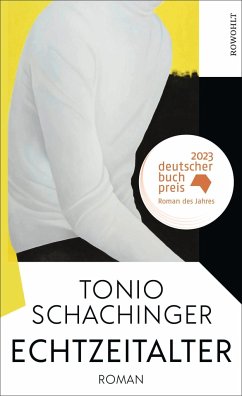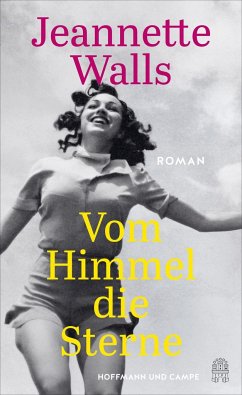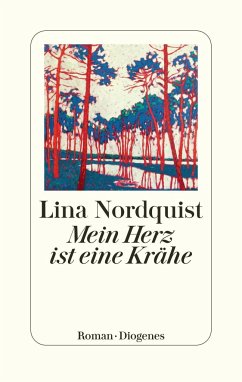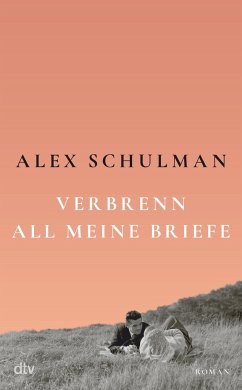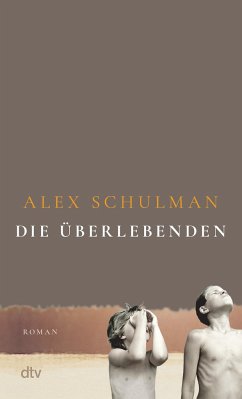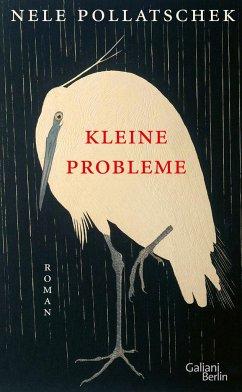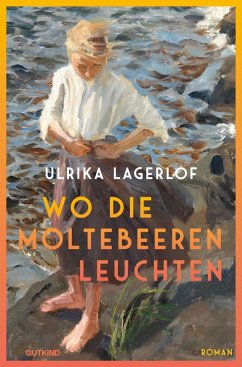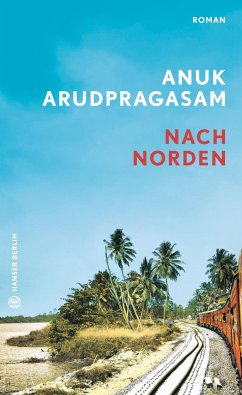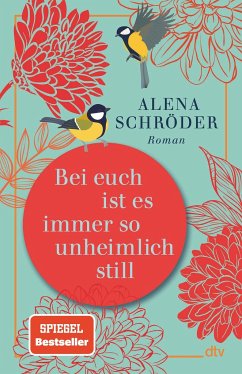Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Über die Macht der Erinnerung und das, was wir Familie nennenEin Zug, drei Menschen und ihre miteinander verwobenen Schicksale: Nach 'Die Überlebenden' und 'Verbrenn all meine Briefe' erzählt Alex Schulman hier erneut mit großer emotionaler Wucht.Ein Zug fährt durch eine Sommerlandschaft. An Bord sind ein Ehepaar in der Krise, ein Vater mit seiner kleinen Tochter sowie eine Frau, die das Rätsel ihres Lebens lösen will. Sie alle fahren nach Malma, einen kleinen Ort, wenige Stunden von Stockholm entfernt, umgeben von Wäldern. Und keiner von ihnen weiß, wie ihre Schicksale verwoben sind ...
Über die Macht der Erinnerung und das, was wir Familie nennen
Ein Zug, drei Menschen und ihre miteinander verwobenen Schicksale: Nach 'Die Überlebenden' und 'Verbrenn all meine Briefe' erzählt Alex Schulman hier erneut mit großer emotionaler Wucht.
Ein Zug fährt durch eine Sommerlandschaft. An Bord sind ein Ehepaar in der Krise, ein Vater mit seiner kleinen Tochter sowie eine Frau, die das Rätsel ihres Lebens lösen will. Sie alle fahren nach Malma, einen kleinen Ort, wenige Stunden von Stockholm entfernt, umgeben von Wäldern. Und keiner von ihnen weiß, wie ihre Schicksale verwoben sind und ob das, was sie in Malma erwartet, ihrem Leben nicht eine neue Wendung geben wird.
In bestechender Prosa baut Alex Schulman seine Erzählung auf: wie einen Zug, der durch die Zeit fährt und in dem jedes Kapitel ein eigener Waggon ist, der an den nächsten angehängt wird. Lässt sich die Zukunft frei gestalten, oder ist sie durch Vergangenes vorgezeichnet?
»Ein tief bewegender Roman, der zu Herzen geht. Ein großes Leseerlebnis.« Aftonbladet
»Mit 'Endstation Malma' bestätigt Alex Schulman, dass er einer der größten Erzähler unserer Zeit ist.« Ölandsbladet
Ebenfalls von Alex Schulman bei dtv erschienen sind:
'Die Überlebenden'
'Verbrenn all meine Briefe'
Ein Zug, drei Menschen und ihre miteinander verwobenen Schicksale: Nach 'Die Überlebenden' und 'Verbrenn all meine Briefe' erzählt Alex Schulman hier erneut mit großer emotionaler Wucht.
Ein Zug fährt durch eine Sommerlandschaft. An Bord sind ein Ehepaar in der Krise, ein Vater mit seiner kleinen Tochter sowie eine Frau, die das Rätsel ihres Lebens lösen will. Sie alle fahren nach Malma, einen kleinen Ort, wenige Stunden von Stockholm entfernt, umgeben von Wäldern. Und keiner von ihnen weiß, wie ihre Schicksale verwoben sind und ob das, was sie in Malma erwartet, ihrem Leben nicht eine neue Wendung geben wird.
In bestechender Prosa baut Alex Schulman seine Erzählung auf: wie einen Zug, der durch die Zeit fährt und in dem jedes Kapitel ein eigener Waggon ist, der an den nächsten angehängt wird. Lässt sich die Zukunft frei gestalten, oder ist sie durch Vergangenes vorgezeichnet?
»Ein tief bewegender Roman, der zu Herzen geht. Ein großes Leseerlebnis.« Aftonbladet
»Mit 'Endstation Malma' bestätigt Alex Schulman, dass er einer der größten Erzähler unserer Zeit ist.« Ölandsbladet
Ebenfalls von Alex Schulman bei dtv erschienen sind:
'Die Überlebenden'
'Verbrenn all meine Briefe'
Alex Schulman,geboren 1976, ist einer der populärsten schwedischen Schriftsteller. Sein Roman ¿Die Überlebenden¿, 2021 bei dtv erschienen, wurde in 30 Sprachen übersetzt. Mit ¿Verbrenn all meine Briefe¿, bei dtv 2022, gelang ihm in Schweden 2018 der Durchbruch als literarischer Autor.
Produktdetails
- Verlag: DTV
- Originaltitel: Malma Station
- 1. Auflage
- Seitenzahl: 320
- Erscheinungstermin: 12. Oktober 2023
- Deutsch
- Abmessung: 208mm x 129mm x 31mm
- Gewicht: 422g
- ISBN-13: 9783423283533
- ISBN-10: 342328353X
- Artikelnr.: 67760188
Herstellerkennzeichnung
dtv Verlagsgesellschaft
Tumblingerstraße 21
80337 München
produktsicherheit@dtv.de
So wenig braucht der schwedische Erfolgsautor Alex Schulmann um eine neue, emotional-packende und gut konstruierte (Familien-) Erzählung zu schreiben. Madame 20231101
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Rezensentin Katharina Granzin findet erschreckend und tröstlich zugleich, was Alex Schulman in seinem neuen Roman über den Egoismus und die Gedankenlosigkeit der Erwachsenen ihren Kindern gegenüber zu sagen hat. Schließlich sind die Elternfiguren in diesem Buch nicht gefühlskalt oder gleichgültig, sie können es nur nicht anders, stellt Granzin fest. Das Gerüst, auf das Schulman seine Mehrgenerationengeschichte aufzieht, die immer gleiche Zugfahrt in den fiktiven schwedischen Ort Malma, laut Granzin eine Art Fluchtpunkt und Sehnsuchtsort, überzeugt die Rezensentin ebenso wie die Schilderungen kindlicher Verletzlichkeit im Buch.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Ein tief bewegender Roman, der zu Herzen geht.« Aftonblade
In einem Zug fährt ein Vater mit seinem Kind, fährt ein Ehepaar, das nach vielen Streitigkeiten verschiedene Auffassungen von der Zukunft hat, und eine junge Frau, die endlich wissen will, was in der Vergangenheit geschehen ist. Alle diese Menschen sind miteinander verbunden, ihre …
Mehr
In einem Zug fährt ein Vater mit seinem Kind, fährt ein Ehepaar, das nach vielen Streitigkeiten verschiedene Auffassungen von der Zukunft hat, und eine junge Frau, die endlich wissen will, was in der Vergangenheit geschehen ist. Alle diese Menschen sind miteinander verbunden, ihre Schicksale miteinander verwebt. Sie fahren nach Malma, einen kleinen Ort, der wenige Stunden von Stockholm entfernt ist.
Ich muss mich hier zurückhalten, denn obwohl ich meine Begeisterung laut herausrufen will, möchte ich noch lieber jeder Leserin und jedem Leser das Erstaunen, das Begreifen und das Entzücken belassen, das mich immer wieder beim lesen ergriffen hat, als erneut ein Puzzleteil zum anderen fand und noch weitere dann das große Ganze vervollständigten. Dabei war eine übermäßige Spannung anfangs fast gar nicht vorhanden, diese baute sich kontinuierlich von Kapitel zu Kapitel auf, bis dies so unerträglich wurde, dass ich fast verrückt vor Neugierde geworden bin. Immer mehr Einzelheiten kamen hinzu, Zusammenhänge wurden klar, ich begriff, wer die Personen sind, denen ich seitenlang gefolgt bin. Ab da bin ich dem Buch verfallen.
Was für eine komplexe Handlung, wie passend dies alles ineinandergriff! Trotz der Sprünge zwischen Personen, Jahren und verschiedenen Handlungen, es war ein permanentes hin und her, gab es keinen Moment, in dem ich verwirrt gewesen bin. Ich war im Gegenteil total begeistert und hätte am liebsten sofort allen mitgeteilt, wie toll dieses Buch, wie großartig diese Geschichte ist. Unbedingt wollte ich wissen, wie es ausgeht, aber nicht, dass es endet; im Zwiespalt gefangen genoß ich die Erzählung, inhalierte förmlich jedes Wort, erfreute mich an Sätzen, Absätzen, Kapiteln und bekam doch nicht genug. Die Auflösung erstaunte mich, ein solches Ende habe ich nicht erwartet, war aber entzückt darüber, wie gut es gepasst hat.
Es ist ein trauriges, zeitweise sehr melancholisches Buch. Die Traurigkeit zieht sich durch die Erzählung, nur manchmal flacht sie ab und lässt die Hoffnung durch, die unermüdlich an die Oberfläche kommen will. Für mich ein lesenswertes Buch, ein Highlight gar, das mir unvergessliche Lesestunden beschert hat. Volle Punktzahl gibt es dafür von mir.
Weniger
Antworten 9 von 9 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 9 von 9 finden diese Rezension hilfreich
Endlose Bahnreise
"Endstation Malma" von Alex Schulman erzählt eine Geschichte auf eine ganz besondere Art und Weise.
Ein Zug fährt nach Malma, ein kleiner Ort in den Wäldern, etwas entfernt von Stockholm. Wir begleiten mehrere Reisende, zu verschiedenen Zeiten.
Wir …
Mehr
Endlose Bahnreise
"Endstation Malma" von Alex Schulman erzählt eine Geschichte auf eine ganz besondere Art und Weise.
Ein Zug fährt nach Malma, ein kleiner Ort in den Wäldern, etwas entfernt von Stockholm. Wir begleiten mehrere Reisende, zu verschiedenen Zeiten.
Wir erleben hier ein Ehepaar, das sich nicht mehr gut versteht, eine junge Frau mit einem Familienalbum voller Fotos und einen Vater mit seiner Tochter.
Nach und nach versteht man die Beziehungen der Personen zueinander und was diese Reisen für sie zu bedeuten haben.
Alle diese Menschen tragen Verletzungen in sich, mit sich und hier erlebt man ihren Versuch, diese zu verstehen, zu verarbeiten.
Wird Unglück vererbt, wird es weitergegeben in die nächsten Generationen? Und worum geht es hier, was ist in Malma geschehen?
Sehr geschickt, mit einem guten, eindringlichen Schreibstil, setzt der Autor hier die Geschichte zusammen, in Zeitsprüngen und auch wechselnden Perspektiven und darin ist er meisterlich.
Bis ganz zum Schluss bindet der Autor den Lesenden an die Geschichte und lässt ihn nicht los, ehe das letzte Wort gelesen ist. Das ist grandios gemacht, eine starke Geschichte, die Mut macht in all ihrer Trauer und Wut.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
»»Ich will nicht, dass du mir erklärst, warum es dir schlecht geht!«, brüllt er. »Ich will, dass du etwas dagegen tust!«« Oskar zu Harriet (S. 282)
In seinem neuen Roman »Endstation Malma« 🦅 schreibt der schwedische Autor …
Mehr
»»Ich will nicht, dass du mir erklärst, warum es dir schlecht geht!«, brüllt er. »Ich will, dass du etwas dagegen tust!«« Oskar zu Harriet (S. 282)
In seinem neuen Roman »Endstation Malma« 🦅 schreibt der schwedische Autor Alex Schulman (Übersetzung 🇸🇪: Hanna Granz) aus der Perspektive von drei Personen - Harriet, Oskar & Yana - erneut über Familie, Generationentraumata, Depression, Beziehungsproblemen, Verlust, Freiheit 🦅 und die Macht unserer Erinnerungen. Setting des Romans sind drei Zugfahrten auf drei Zeitebenen 🛤️ ,in denen Lesende über die Erinnerungen der drei Personen immer mehr die Familiengeschichte, das große Ganze und schlussendlich das Drama begreifen. 💔
Es ist ein Roman, der zum Nachdenken anregt, der beschäftigt und schmerzt. Es zerreißt einem das Herz, wenn zwei Kinder ihren sich streitenden und vor der Scheidung stehenden Eltern im Bett lauschen und hören, dass weder Mutter noch Vater die eine Tochter bei sich behalten wollen. Es ist nicht leicht zu lesen, wie viel Schmerz Kinder erfahren, wenn Eltern sich so streiten, dass die Beziehung und Familie zerbricht.
»Wann weiß man, dass man ein Kind verloren hat?« Oskar 💭 (S. 110)
Hilft es, die eigene Kindheit immer und immer wieder zu durchleben? Wie viel Erinnerung und Aufarbeitung tut uns gut? Wie sehr beeinflusst uns unsere Vergangenheit?
»Er legt einen Arm um sie, und sie lehnt den Kopf an seine Brust, und dann verschwindet sie erneut, taucht durch die Jahrzehnte. Offenbar gefällt es ihr dort. Die geraden Linien von der Kindheit bis in die Gegenwart hinauf, alles, was man jetzt ist, kann und muss durch das erklärt werden, was einem früher widerfahren ist. « (S. 233)
Das Alex Schulman ein meisterhafter Erzähler ist, wissen wir spätestens seit »Verbrenn all meine Briefe«💌. Mit seinem neuen Buch hat er sich noch tiefer in mein Herz geschrieben. Gekonnt verbindet er persönliche Kindheitserinnerungen und -Traumata mit fiktiven Figuren und schreibt so krass authentische, emotionale und literarisch anspruchsvolle Romane. 😮💨 Noch mehr beeindruckt hat mich der Roman und das Werk des Autors nach seiner Lesung, in der ich realisiert habe, wie viel Wahres, Erlebtes, Traumatisierendes der Autor in seinen Roman verarbeitet. Die Geschichten sind frei erfunden, dennoch ist alles passiert. 💔
»Yana doesn’t make any progress at all. She has no journey. That’s exactly what I want, because that’s how life works. Sometimes you just stand still.« Alex Schulman, Lesung HH 18.10.23 🧡
So viel Kluges, so viel Emotionales und so viel Gefühl lesen sich aus diesem und den anderen Büchern des Schweden. Ich bedaure, dass es so viele mehr Bücher von ihm nur auf Schwedisch gibt, und noch mehr, dass mein Schwedisch nicht ausreicht, um diese zu lesen. 😢 Umso mehr freue ich mich auf alle weiteren deutschen Übersetzungen des Autors - looking at you dear dtv 👀❤️
Große Leseempfehlung für alles von Alex Schulman und im Besonderen seinen neuen Roman.
[CN: Depression, Selbstmord]
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Alex Schulman hat mit "Endstation Malma" einen bewegenden und emotionalen Familienroman geschrieben. Bewegender Roman
Schulman nähert sich den handelnden Personen in der Form einer Zugfahrt von Stockholm nach Malma, einem kleinen Ort der einige Stunden von Stockholm entfernt liegt. …
Mehr
Alex Schulman hat mit "Endstation Malma" einen bewegenden und emotionalen Familienroman geschrieben. Bewegender Roman
Schulman nähert sich den handelnden Personen in der Form einer Zugfahrt von Stockholm nach Malma, einem kleinen Ort der einige Stunden von Stockholm entfernt liegt. In drei Handlungssträngen erzählt er die Geschichte von einem Vater und seiner Tochter, einer jungen Frau und einem Paar. Aus unterschiedlichen Beweggründen fahren diese nach Malma, doch sie haben mehr miteinender zu tun als man zunächst vermutet. Die Entwickung der einzelnen Geschichten, mit ihren Gedanken, sowohl verschieden als auch mit Überschneidungen, könnte den Roman verwirrend machen, trägt jedoch sehr zur Spannung zum Vergnügen der Lektüre bei. Interessanten Stoff bieten die Überlegungen des Autors über das Wesen zwischenmenschlicher Beziehungen. Besonders bleibt der Satz "Du bist nicht allein" in Erinnerung.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Das Buch nimmt uns mit auf verschiedene Blickwinkel, unterschiedlicher Personen. Vorrangig wird die Perspektive von Harriet betrachtet, die getrennt von Schwester und Mutter bei ihrem Vater groß wird. Alex Schulman beleuchtet in Endstation Malma mehrere Beziehungsmuster, die entweder die …
Mehr
Das Buch nimmt uns mit auf verschiedene Blickwinkel, unterschiedlicher Personen. Vorrangig wird die Perspektive von Harriet betrachtet, die getrennt von Schwester und Mutter bei ihrem Vater groß wird. Alex Schulman beleuchtet in Endstation Malma mehrere Beziehungsmuster, die entweder die Personen zu sich selber haben oder auch zueinander. Es schwingen immer leicht psychische Repressionen der Familie mit, die zwar den Protagonist:innen selber nicht bewusst sind, mir beim lesen aber schmerzlich aufgefallen sind. Der Autor bringt durch seinen Schreibstil nicht nur eine tragische Familiengeschichte zu Papier, sondern schaffte es auch bei mir zu Gedanken zur eigenen Vergangenheit anzuregen. Ein wirklich wirkungsvoller Roman, der es den Lesenden nicht leicht macht und auch Unbehagen ausruft. Und dennoch eine volle Empfehlung, da es so nah an der Realität geschrieben ist.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Zum Inhalt:
In einem Zug, der durch Schweden fährt sitzen verschiedene Menschen, deren Schicksal miteinander verwoben ist, doch das wissen sie zu diesem Zeitpunkt nicht. Alle sind unterwegs Richtung Malma. Es handelt sich um eine Ehepaar, dass in einer Krise steckt; ein Vater mit seiner …
Mehr
Zum Inhalt:
In einem Zug, der durch Schweden fährt sitzen verschiedene Menschen, deren Schicksal miteinander verwoben ist, doch das wissen sie zu diesem Zeitpunkt nicht. Alle sind unterwegs Richtung Malma. Es handelt sich um eine Ehepaar, dass in einer Krise steckt; ein Vater mit seiner Tochter und eine Frau, die das Rätsel um ihr Leben lösen will.
Meine Meinung:
Der Beschreibung nach könnte man meinen, dass die Personen gleichzeitig im Zug sitzen und das hatte ich auch so erwartet, aber dem ist nicht so. Das zu begreifen, hat mich erst einmal eine Weil gekostet bis ich die Zeitsprünge wahrgenommen habe. So richtig kann ich gar nicht sagen, ob mir das Buch gefallen hat oder nicht, aber eins weiß ich auf jeden Fall und das ist dass ich den Schreibstil irgendwie mochte. Die Geschichten der Protagonisten sind emotional und tragisch und erst zum Ende des Buches im gesamten Ausmaß zu erfassen.
Fazit:
Ungewöhnlich
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Der schwedische Bestsellerautor versteht es, schwierige Familienbeziehungen zu beschreiben. Wie in den beiden Vorgängerbänden "Die Überlebenden" und "Verbrenn all meine Briefe" erzählt er von gestörten, traumatischen Verhältnissen. Drei Menschen sind …
Mehr
Der schwedische Bestsellerautor versteht es, schwierige Familienbeziehungen zu beschreiben. Wie in den beiden Vorgängerbänden "Die Überlebenden" und "Verbrenn all meine Briefe" erzählt er von gestörten, traumatischen Verhältnissen. Drei Menschen sind unterwegs in einem Zug: ein zehnjähriges Mädchen mit seinem Vater, ein junger Mann mit seiner Frau, die ihm vor der Trennung den Ort zeigen möchte, in dem sie aufgewachsen ist, eine junge Frau auf der Suche nach ihrer Mutter. Erst allmählich wird deutlich, dass sie alle auf der gleichen Strecke unterwegs sind, aber zu ganz verschiedenen Zeiten: 1976, 2002 und heute und dass es sich um eine Familie handelt: das kleine Mädchen wird die verheiratete Frau, deren Tochter die suchende Frau ist. Sehr raffiniert werden die Erzählstränge miteinander verwoben. Man spürt das Unheil, das diese Familie bedroht, die Sprachlosigkeit über Generationen hinweg. Spannend bis zur letzten Seite. Hervorragend!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Einfühlsam beschriebene Geschichten dreier Generationen einer Familie
Das Cover zeigt einen Adler im Flug. Leider ist er nur teilweise direkt sichtbar, der vordere Teil des Vogels ist eingeklappt. Insgesamt ist diese Bildaufteilung unglücklich gelöst. Der Bezug zum Roman ist …
Mehr
Einfühlsam beschriebene Geschichten dreier Generationen einer Familie
Das Cover zeigt einen Adler im Flug. Leider ist er nur teilweise direkt sichtbar, der vordere Teil des Vogels ist eingeklappt. Insgesamt ist diese Bildaufteilung unglücklich gelöst. Der Bezug zum Roman ist einleuchtend. Hauptsächlich auf der Bahnfahrt von Stockholm nach Malma befinden sich zeitlich versetzt drei Generationen einer Familie mit ihren Gedanken, Problemen, Erinnerungen und der Suche nach Antworten. Im Mittelpunkt steht Harriet als Kind, als verheiratete Frau und als Mutter von Yana. Ihre hohe Sensibilität und große Verletzlichkeit in ihrer Kindheit wird einfühlsam beschrieben, hervorgerufen durch das streitbare Verhalten ihrer Eltern. Später scheint sich ihr eigenes zerstörerisches Verhalten als Erwachsene in ihrer Ehe zu wiederholen, immer noch das Rätsel ihres Lebens lösen zu wollen. Als Kind voller Ängste und stets auf der Suche nach Sicherheit besonders nach der elterlichen Scheidung, gibt Harriet kein gutes Beispiel als Mutter ihrer Tochter Yana wieder. Der Charakter der Letztgenannten kommt nur in recht wenigen Facetten vor: Nur mithilfe eines kindlichen Fotoalbums ihrer Mutter befindet auch sie sich in Malma auf Spurensuche. Herriets‘ Ehemann Oskar wird als depressive, verzweifelte Figur beschrieben, sodass insgesamt ein düsteres Bild einer unglücklichen Familie gezeichnet wird, umgeben von einem sich wiederholenden Fluch.
Ist auch unsere Zukunft durch Vergangenes wie in diesem Roman vorgezeichnet oder lässt sie sich frei gestalten mit neuer Wendung?
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Endstation Wahrheit - ausdrucksstark erzählt
"Wann verliert man sein Kind?" - Das ist eine der Fragen, die sich wie ein roter Faden durch den fesselnd geschriebenen neuen Roman "Endstation Malma" von Alex Schulman zieht.
Der wunderbar erzählte Roman spielt in …
Mehr
Endstation Wahrheit - ausdrucksstark erzählt
"Wann verliert man sein Kind?" - Das ist eine der Fragen, die sich wie ein roter Faden durch den fesselnd geschriebenen neuen Roman "Endstation Malma" von Alex Schulman zieht.
Der wunderbar erzählte Roman spielt in einem Zug und wird aus den Perspektiven dreier Personen erzählt, die zu verschiedenen Zeiten, in der Vergangenheit und in der Gegenwart, unterwegs sind und auf der Suche nach Antworten sind.
Was werden sie am Ziel ihrer Reise finden? Den Drang danach, die Antwort auf diese Frage zu erfahren, lässt einen nur so durch die Seiten fliegen, was dank des einnehmenden, feinen und ausdrucksstarken Schreibstils des Autors einem auch nicht wirklich schwerfällt.
Man folgt der jungen Harriet, die bei ihrem Vater lebt, nachdem ihre Mutter und ihre Schwester sie verlassen haben. 20 Jahre später begleitet man Oskar, der eine Beziehung mit ebenjener Harriet eingeht, der, als die Beziehung scheitert, allein bleibt, mit seiner Tochter. In der Gegenwart folgt man dann der nun erwachsenen Tochter Yana.
Alle drei Handlungsstränge sind gespickt mit Erinnerungen, Gesprächen und Geschichten, die dazu führen, dass man fünf Protagonisten gut kennenlernt. Ständig wird zwischen den drei Handlungsperspektiven hin und her gewechselt, die dann alle, für sich mehr oder weniger befriedigend (Yana) auf die Auflösung am Bahnhof von Malma zusteuern, an dem schwedischen Bahnhof, an dem alle drei Schicksale auf besondere Art und Weise miteinander verbunden sind. So viel sei verraten, die Auflösung ist vor allem eine schmerzvolle, aber hat auch eine liebvolle Komponente.
Auch wenn es einen Erzählstrang in der Gegenwart gibt, liegt der Schwerpunkt in der Vergangenheit und ihren Auswirkungen. Hierbei offenbart sich auch eine Schwäche des Romans, die Gegenwartshandlung erfährt zum Ende hin nicht die gleichen starken Abschluss wie die beiden in der Vergangenheit.
Anfangs waren die verschiedenen Erzählstränge jedoch etwas verwirrend, doch sobald sich einem die Struktur des Romans offenbart, taucht man gebannt in die Geschichte über Familiengeheimnisse, Ungerechtigkeiten, die über Generationen weitergegeben werden, und vergangenen Ereignissen ein, deren Auswirkungen bis in die Gegenwart spürbar sind, ein.
"Endstation Malma" ist ein starkes und berührendes Werk von Alex Schulman, mit dem er einmal wieder sein Talent, fesselnde Geschichten mit vielschichtigen Charakteren zu schreiben, unter Beweis stellt.
Trotz kleiner Schwächen, eine klare Leseempfehlung.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Ruhige Geschichte über Familie
Alex Schulman schreibt in "Endstation Malma" über drei Protagonist*innen und deren Reise:
Harriet, die mit ihrem Vater auf dem Weg zu einer Beerdigung ist.
Oskar mit seiner Freundin, nach einem großen Streit.
Und Yana, im Handgepäck …
Mehr
Ruhige Geschichte über Familie
Alex Schulman schreibt in "Endstation Malma" über drei Protagonist*innen und deren Reise:
Harriet, die mit ihrem Vater auf dem Weg zu einer Beerdigung ist.
Oskar mit seiner Freundin, nach einem großen Streit.
Und Yana, im Handgepäck ein Fotoalbum ihres Vaters.
Was die drei außer ihrem Ziel, dem Bahnhof Malma, verbindet, wird den Leser*innen im Laufe des Buches offenbart.
Schulman erzählt dabei in einer ruhigen, unaufdringlichen Art die Geschichte dreier Generationen und verwebt ihre Geschichten dabei nach und nach zu einer gemeinsamen.
Zunächst scheint es so, als spielten die drei Perspektiven sich gleichzeitig ab, schnell wird einem aber bewusst, dass Jahrzehnte zwischen den einzelnen Schicksalen liegen.
Dabei vermittelt der Autor eine Botschaft: Was wir als Kinder erleben, beeinflusst unser Verhalten als Erwachsene.
Wie schon in "Die Überlebenden" kreiert Schulman einen einzigartigen Aufbau: Verschiedene Charaktere, verschiedene Zeiten, verschiedene Geschichten, die an einem gemeinsamen Schauplatz stattfinden: Im Zug nach Malma.
Durch diese Besonderheit hat mich das Buch direkt in seinen Bann gezogen und nicht wieder losgelassen.
Er schafft es außerdem, ganz gewöhnlichen Menschen Leben einzuhauchen, tiefe Gefühle zu erwecken und Empathie für jeden Protagonisten herbeizuführen.
Diese Geschichte über eine gewöhnliche schwedische Familie kam so leise und unauffällig daher und hat mich dabei voll und ganz ergriffen. Alex Schulman ist meiner Meinung nach ein großartiger Erzähler und ich hatte direkt nach dem Beenden des Buches das Bedürfnis, es noch einmal zu lesen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für