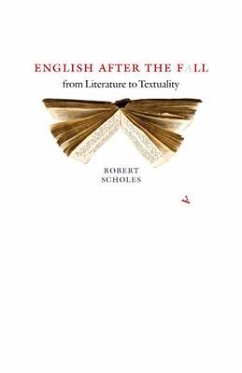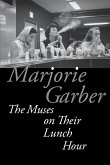Robert Scholes's now classic Rise and Fall of English was a stinging indictment of the discipline of English literature in the United States. In English after the Fall, Scholes moves from identifying where the discipline has failed to provide concrete solutions that will help restore vitality and relevance to the discipline.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Ein amerikanischer Literaturprofessor will das Studium vom Kopf auf die Füße stellen: Das Ziel von Fächern wie Anglistik, Germanistik oder Romanistik sei nicht die Interpretation von Texten, sondern gut schreiben, sprechen und denken zu können.
Vor vierzehn Jahren publizierte Robert Scholes, Anglist an der amerikanischen Browne University, ein Buch über den Niedergang der Englisch-Studien an den Universitäten (The Rise and the Fall of English: Reconstructing English as a Discipline, Yale University Press 1998). Für diesen Niedergang, den man hierzulande genauso gut und mit denselben Argumenten an der Germanistik oder der Romanistik beobachten könnte, machte er die Literaturwissenschaft verantwortlich. Im Seminar werde nur noch geübt, was Professoren mit Texten machen: Es wird historisches Wissen über sie angehäuft, es werden Theorien an ihnen ausprobiert, es werden Interpretationen dieser Texte angefertigt.
Das liebste Kind der Literaturprofessoren seien darum auch schwierige Texte, "dunkle", "hermetische". Die literarische Moderne, die sich um 1900 herum etablierte, kam der im selben Zeitraum aufsteigenden wissenschaftlichen Beschäftigung mit Literatur insofern gerade recht.
Damit, so lautete Scholes' These (F.A.Z. vom 16. September 1998), unterrichte man an den allermeisten Studierenden vorbei. Andere als Forschungsinteressen fänden sich für Literatur nicht mehr, der Sinn der Erziehung vor und an Texten erschöpfe sich in akademischen Übungen. Viele gute Studierende, kann man ergänzen, wenden sich darum von den Philologien ab und den Film- oder Medienwissenschaften zu; obwohl ihnen dort unter Umständen an Gegenständen, die ihnen mehr liegen, dieselbe Einstellung begegnet.
Jetzt hat Robert Scholes, der selbst ein hochdekorierter Autor mehrerer literaturwissenschaftlicher Grundlagenwerke - über den Strukturalismus, die intellektuelle Magazinkultur der Moderne, den ästhetischen Modernismus - ist, einen zweiten Band zu seinem Thema vorgelegt: "English after the Fall. From Literature to Textuality" (Iowa University Press 2011). Er enthält Beispiele dafür, was man stattdessen und sinnvollerweise mit Literatur in Universitätsseminaren anfangen kann. Die Geisteswissenschaften nämlich haben, so sein Gedanke, in der gegenwärtigen Wissenschaftswelt - anders als Informatik, Chemie oder Maschinenbau - Probleme nicht darum, weil sie nutzlos sind, sondern weil sie zögern, sich als nützlich zu begreifen und zu fragen, was an ihrem Studium denn nützlich sein könnte.
Dazu müsse man zunächst literarische Werke als Mittel und nicht als Zweck des Sprachenstudiums erkennen. Scholes spricht überhaupt nicht gern von "Literatur" als dem Gegenstand des Unterrichts, sondern von "Textualität". Das klingt noch akademischer, meint aber etwas sehr Praktisches: Das, was die Lektüre von Literatur für jedermann nützlich macht, sind Eigenschaften, die auch andere Gegenstände haben: Filme, Opern, Essays, Verfassungen und andere heilige Texte, beispielsweise die Paulusbriefe oder die Schöpfungsgeschichte des Alten Testaments, aber auch Werbetexte oder Zeitungsaufsätze.
Die Pointe von Scholes wäre missverstanden, würde man jetzt vermuten, er tische einfach nur den Evergreen "Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft" auf, um an Universitäten auch Comics oder Popsongs interpretieren zu lassen. Was ja auch längst durchgesetzt ist. Worum es ihm geht, ist nicht die Erweiterung des Kanons erforschenswürdiger Objekte. Vielmehr soll das Literaturstudium auf alle Gattungen und Textsorten ausgedehnt werden, weil man an Opern, Gedichten, Rechtstexten und Filmen gleichermaßen gut lernen kann, wie eine Erzählung aufgebaut wird. Oder ein Argument. Oder eine Täuschung.
Scholes liefert zum Nachweis sowohl Analysen von Sonetten, die ein Argument enthalten - Robert Frosts "Design", das die Frage stellt, in wie kleinen Strukturen hinein man sich Schöpferabsichten wirksam vorstellen soll -, wie von Verfassungsparagraphen, die sich rhetorischer Figuren bedienen. Woran erkennt man, dass ein Text "fundamentalistisch" gedeutet wird? Was geschieht, wenn ein Stoff die Gattung wechselt, etwa "Othello" von Shakespeare zu Verdi?
An der Vorgeschichte eines der besten Western aller Zeiten, "The Man Who Shot Liberty Valance", erläutert Scholes, welche Bedeutung heilige Texte (die Verfassung) und säkulare (Zeitungen) für das Verständnis der Gegenwart haben. Und was es mit der Technik auf sich hat, dasselbe zweimal zu erzählen. Und wie komplexe Heldenfiguren angelegt sind. Und wie aus einer simplen Novelle ein Drehbuch entstehen kann. Die Aufgabe universitärer Englisch-Institute sei es, anhand solcher Fragen aus den Studierenden bessere Produzenten und Konsumenten - Scholes scheut den Begriff nicht und vermeidet das feinere "Rezipienten" - von Texten zu machen. Das Schreiben aber lerne man beim Lesen, eigene "Creative Writing"-Kurse seien überflüssig. Jeder Professor sollte "Schreiben" unterrichten können; zum Beispiel "Schreiben über Flaubert", was nicht dasselbe ist wie "Ein (halb)wissenschaftliches Referat über Literatur zu Flaubert". Es genüge aber auch nicht, den Studenten die Bücher der klassischen Leselisten zuzuwerfen und nur "fang!" zu rufen. Sie versuchen, so Scholes unumwunden, etwas zu verkaufen, was niemand haben will, und liefern nicht, woran Interesse besteht. Aus dieser Situation komme man nur heraus, wenn die Professoren begriffen, dass sie etwas zu Rhetorik von Filmen zu sagen haben, und die Studierenden begriffen, dass Shakespeare-Lektüre nützlich ist.
Der Einwand, mit dem ein solcher Vorschlag hierzulande rechnen müsste, lautet: Das sind Aufgaben für Gymnasiallehrer, aber nicht für Forscher, die der Einheit von Forschung und Lehre dadurch huldigen, dass sie nur lehren, worüber sie auch geforscht haben. Doch diese Entgegnung kann man gleich zweimal herumdrehen: Die Aufgaben der Universität werden in Zukunft immer mehr denen ähneln, die man früher den Oberstufen zuwies. Und: Die eigentliche Funktion der Literaturkurse an Universitäten besteht in der Ausbildung von Lehrern und anderen Leuten, die etwas anderes mit Texten anfangen können sollen, als sie nach Maßgabe der Literaturwissenschaft und ihrer Verfahren zu erforschen.
JÜRGEN KAUBE
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main