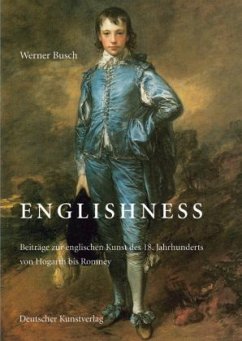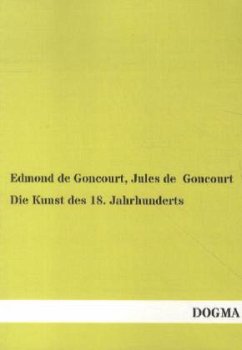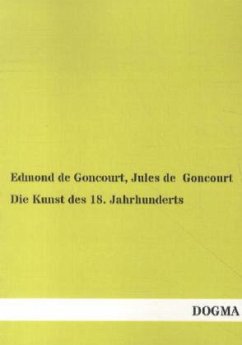Werner Busch hat sich seit seinem ersten Buch über William Hogarths ikonographische Zitate (Nachahmung als bürgerliches Kunstprinzip, 1973) als einer der wenigen deutschen Kunsthistoriker immer wieder mit britischer Malerei und Graphik beschäftigt, nicht zuletzt in Das sentimentalische Bild (1993). Der vorliegende Band versammelt zehn Aufsätze zum Thema, die zum Teil an entlegenen Stellen publiziert waren, und nun einen Bogen vom Beginn bis zum Ende des 18. Jahrhunderts spannen. Neben Hogarth werden mit Joshua Reynolds, Joseph Wright of Derby, Thomas Gainsborough und George Romney die prominentesten englischen Künstler des 18. Jahrhunderts in den Blick genommen.

Man sehe das unklassische Herkulesbild des Sir Joshua Reynolds: Werner Busch mistet die ikonographische Tradition aus, um den Genius der englischen Malerei freizulegen.
Was ist ein Tragöde? Ein Schauspieler, der nichts verdient. Die Definition gilt jedenfalls in einer Marktgesellschaft. David Garrick gefiel den Kennern als Hamlet oder Lear ebenso wie als komische Person in Farcen, die er sich selbst ausgedacht hatte. In den Londoner Theatern seiner Zeit wurden Tragödie und Komödie nacheinander gegeben, das ernste Stück von sechs bis sieben Uhr, das heitere danach. Nach Ladenschluss strömte das große Publikum in die Theater, der Mann von Welt konnte diskret im Saal bleiben. Werner Busch fasst zusammen: "Die Tragödie mochte noch so anspruchsvoll sein, die Komödie entschied, ob ein Theater florierte oder nicht."
So wird man verstehen, dass Garrick auf dem Gemälde von Joshua Reynolds, das ihn zwischen Personifikationen der Komödie und der Tragödie zeigt, mit verlegenem Lächeln, entschuldigendem Augenaufschlag und ausgebreiteten Händen dem handfesten Werben der anmutigen Unterhaltungskunst nachgibt und die strenge Hüterin des klassischen Anspruchs vergeblich auf den Himmel verweisen lässt. Er ist Unternehmer, was soll er machen? Hätte er es als Kulturschande beklagen sollen, dass niemand mehr in sein Shakespeare-Theater ging? Reynolds hätte zur Darstellung eines Anfalls von kulturkritischem Pathos gewiss eine Pose des tobenden Ajax im Repertoire gehabt, aber Garrick hätte in solchem Kostüm eine lächerliche Figur abgegeben.
Drei Schüler von Werner Busch haben Aufsätze des Berliner Kunsthistorikers zur englischen Kunst gesammelt. Faszinierend ist diese Zusammenstellung auch, weil im Wechsel der Gegenstände das Technische und Professionelle im Zugriff des Interpreten plastisch wird. Wir blicken in die Werkstatt, in der Monographien wie "Das unklassische Bild" und jüngst das Buch über Laurence Sterne und die Kunst (F.A.Z. vom 13. Oktober) entstanden sind. Wie Schauspieler und Historienmaler hat ein Kommentator vom Schlage Buschs Figuren im Angebot, die in verschiedenen Zusammenhängen nützlich sind. Busch macht die wiederholte Probe auf einen Grundgedanken, der auf seine Dissertation über die ikonographischen Zitate bei William Hogarth zurückgeht. Den Genius des goldenen Zeitalters der englischen Malerei findet er im "Witz", in der Mitwirkung des Betrachters an der Produktion des Bildsinns.
Die Bildauffassung, die das unausgedeutete Bild als unvollendet ansah, lässt sich einer bürgerlichen Weltanschauung zuordnen, denn sie eröffnete der Konkurrenz schlagender Einfälle ein unendliches Feld. Jedermann wird gesehen haben, dass Reynolds mit seinem zwischen den Gattungen hin und her gerissenen Garrick einen der meiststrapazierten Topoi einer moralisierenden Klassik aufnimmt, Herkules am Scheideweg. Der parodistische Sinn der Nachahmung stach ebenfalls ins Auge: Der berufsmäßige Heldendarsteller verhält sich unheroisch, entscheidet sich für den leichten Weg.
Nicht fern lag eine bibliographische Assoziation: Der Graf von Shaftesbury hatte seine Philosophie der Malerei am Beispiel des Herkulesurteils entwickelt. Waren die Prinzipien der Historienmalerei, der nach klassischer Meinung höchsten Gattung, zeitlos? Im Disput um diese Frage wird Reynolds, dem gelehrten Akademiepräsidenten, gewöhnlich die Rolle des konservativen Widersachers von Hogarth, dem Entdecker der "modernen moralischen Sujets", zugewiesen. Busch korrigiert das Bild vom Klassizisten Reynolds, ohne es als Irrtum zu verwerfen. Er nimmt raffinierte Retuschen, subtile Umdeutungen vor. Reynolds war es, der in seinen Akademiereden eine Theorie des "wit" vortrug. Garrick lässt er in einem Stück auftreten, in dem es auch um seine eigene Sache geht.
Reynolds inszeniert den Gegensatz von lebendiger Heiterkeit und ernstem Ideal mit malerischen Mitteln, als Nebeneinander zweier Handschriften, die er gleichermaßen beherrscht. Die kunsthistorische Forschung hat schon vor einem halben Jahrhundert erkannt, dass die Komödie in der Manier des Correggio gegeben ist und die Tragödie nach Art Guido Renis. Busch kann nun Werke beider Maler als Vorlagen namhaft machen, die Reynolds wohl auf seiner Italien-Reise gesehen hatte. Die virtuose Verfügung über die klassischen Formen weist Reynolds als modernen Künstler aus: Kein alter Meister hätte eine solche Stilcollage fabriziert. Busch stilisiert Reynolds zum Avantgardisten des Historismus. Bei der Einkleidung der beiden dramatischen Musen sei er "geradezu archäologisch genau" vorgegangen, nach Schnittmustern von den römischen Musensarkophagen.
Hier ist Busch sogar so kühn, aus dem ikonographischen Material auf den Moment der Konzeption des Gemäldes zu schließen - wie die Physiker der Zeit in der Nachfolge Newtons den Schöpfungsakt zur Darstellung bringen wollten. Busch malt sich aus, Reynolds werde wohl durch die Sarkophage auf die Idee gekommen sein, Musenfiguren und Herkulesmotiv zu kombinieren. Warum? "Standardattribut der Melpomene auf den Musensarkophagen ist die Keule."
Ebenso frappant als kongeniale Leistung des nachschöpfenden Witzes ist die Deutung des Sterne-Porträts von Reynolds als Paraphrase eines Rubensschen Satyrn. Eine solide forensische Basis legt der Nachweis, dass Reynolds den Typus tatsächlich vor Augen hatte: Besuchern seines Ateliers zeigte er die Kopie, die er nach einem Satyr des Rubens angefertigt hatte. Als Anatom perspektivischer Feinarbeit zeigt Busch, wie durch die Senkung des Kopfes unter der verrutschten Perücke alle Einzelheiten einer Satyrphysiognomie reproduziert werden, von den ansteigenden Augenbrauen bis zum plattgedrückten Nasenrücken. Fast schon überdeutlich wirkt dann die "Stützhand mit dem langen vom Backenknochen zur Schläfe führenden Zeigefinger", der das Spitzohr vertritt. Sterne lächelt das hintergründige Lächeln des Satyrn und lächelt darüber, dass er einen Satyr darstellt.
Dieses Rollenbewusstsein unterscheidet ihn vom biblischen Lot, der in der Tradition als trunkener Lustbold gelegentlich Satyrzüge erhält. Mit diesem Vergleich sind die von Busch geschlagenen Verbindungen noch nicht erschöpft. Auch Sokrates, den der berauschte Alkibiades im "Gastmahl" des Platon mit den Figuren der Bildhauer vergleicht, die äußerlich die Züge eines Silen tragen, aber im Inneren kleine Götterstatuen bergen, soll mitgemeint sein oder kann jedenfalls in die Gestalt Sternes hineingelesen werden. Die Emblematik illustriert mit dem Silen des Alkibiades das Motto "Meliora latent - Das Bessere ist verborgen".
Spätestens hier überwältigt den Leser der Rausch des nachbildenden Mitdenkens, aber er darf sich dem Hochgefühl getrost überlassen, weil Busch selbst die Risiken seines Verfahrens benennt. Wenn das Schlagende an einem Bild eine gar nicht dargestellte, verborgene Keule sein soll, dann ist, mit Buschs Worten über Hogarth, "ein prekärer Punkt erreicht - tendenziell erschöpft sich das Bild in seiner Entschlüsselung", da nicht das Bild, sondern der Witz in Erinnerung bleibt.
Busch bleibt wie Reynolds Herr seiner Mittel, insoweit eben doch ganz Klassiker, und gibt uns in diesen Studien ein Selbstporträt: Bei der Niederschrift des einen oder anderen Satzes wird auch in seinem Gesicht das Satyrlächeln hervorgetreten sein.
PATRICK BAHNERS
Werner Busch: "Englishness". Beiträge zur englischen Kunst des 18. Jahrhunderts von Hogarth bis Romney.
Deutscher Kunstverlag, Berlin 2010. 248 S., Abb., geb., 48,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Geradezu in einen "Rausch des nachbildenden Mitdenkens" haben diese Aufsätze des Berliner Kunsthistorikers Werner Busch den Rezensenten Patrick Bahners versetzt. Denn wie er hier gelernt hat, hat schon William Hogarths den Genius der englischen Malerei im Witz ausgemacht hat, im Mitdenken des Bildbetrachters. Busch Aufsätze hält er Meisterleistungen in dieser Disziplin, besonders interessiert haben Bahners jedoch zwei Studien. Die eine befasst sich mit dem Joshua Reynolds Bild des Schauspielers David Garrick, der sich, hin und hergerissen zwischen ernster und unterhaltsamer Kunst, der lukrativeren Variante zuwendet. Die andere bezieht sich auf Reynolds Porträt des Schriftstellers Laurence Sternes, in dessen Gesicht Busch das "hintergründige Lächeln des Satyrn" erkenne. So viel interpretatorische Feinarbeit "überwältigt" den Rezensenten.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH