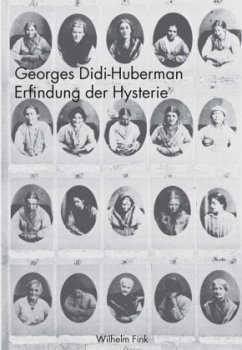Die Hysterie wird es geben, solange sie auf Verständnis trifft / Von Katharina Rutschky
Mit der Hysterie, sei es mit der von Charcot als Bild erfundenen, sei es mit der von Freud ergründeten, hat sich der Feminismus immer schwergetan. Er hat zu dieser überwiegend weiblichen Krankheitswahl Meinungen entwickelt, die einander geradezu ausschließen. Kein Wunder, denn mit dem Attribut hysterisch hantierten nicht nur Ärzte, sondern auch Politiker und Philosophen, wenn sie es mit Abweichungen zu tun bekamen, welche die patriarchalische Ordnung durch deutliche Hinweise auf das weibliche Begehren oder auch nur die Lust auf Bildung, Wissenschaft und Wahlrecht in Frage stellten. Hysterisch ist ein Schimpfwort aus der Kiste der alten Misogynie, und die Hysterie ein Unterkapitel aus einer Geschichte, die Frausein mit Kranksein sehr kurzschlüssig assoziiert.
Auf der anderen Seite gab und gibt es Feministinnen, welche die Hysterie als weibliche Existenzform schlechthin oder als Vorboten einer ungekannten humanen Sensibilität interpretieren. Die Surrealisten feierten 1926 das fünfzigjährige Bestehen der Hysterie, die sie zur großen poetischen Erfindung erklärten. Heute fungieren Frauen weniger als Musen der Kunst denn als Protagonistinnen moralischer Eruptionen, bei denen sie als Opfer Autorität beanspruchen können. Die Frage, ob Frauen mehr als Männer dazu neigen, sich symbolisch der Krankheit zu bedienen, mit allen Konsequenzen, die das heute, im Zeitalter der Frauenbeauftragten, hat - diese Frage beantwortet Elaine Showalter in ihrem neuen Buch ganz nebenbei, aber deutlich. Zu siebzig bis neunzig Prozent sind die Opfer des rituellen Mißbrauchs, der chronischen Müdigkeit, der Persönlichkeitsspaltung, ja selbst der Entführung durch Außerirdische weiblichen Geschlechts.
Man kann nicht umhin, sich zu wundern. Hat sich seit den späten Sechzigern, seit dem Aufbruch der neuen Frauenbewegung gar nichts geändert, oder sind die Frauen zur Hysterie disponiert, wie es die Frauenhasser vorzeiten behauptet haben? Wenn es nicht der wandernde Uterus ist, den die Ärzte seit Hippokrates als Wurzel aller weiblichen Übel ausgemacht haben, was ist es dann, das Frauen so viel häufiger als Männer psychisch und somatisch erkranken läßt und in die Praxis von Ärzten und Psychotherapeuten treibt? In steigender Zahl werden sie dort inzwischen auch von Frauen behandelt, was alte Vorurteile gegen die sogenannte Männermedizin allmählich überflüssig machen sollte; und in einem beunruhigenden Ausmaß kommt es in der Therapie zu einer Kollusion von Hilfesuchenden und Helfern, für welche das aufgeklärte achtzehnte Jahrhundert die Begriffe Aberglauben und Quacksalberei reserviert hatte.
Forciert wird die Konjunktur paranoider Szenarien, die längst als neue Syndrome den Weg in die diagnostischen Handbücher gefunden haben, sicher auch durch die Erwartung der Jahrtausendwende. Wer durch eine glückliche Konstitution vor dem Mitagieren geschützt ist, wer sich gar - was Showalters erklärte Absicht ist - um Schadensbegrenzung bemühen will, steht vor der schwierigen Aufgabe, Strategien im Kampf gegen den Unsinn zu entwickeln. Showalters Versuch, Öl auf die Wogen der psychischen Epidemien neueren Datums zu gießen, ist mit viel Wohlwollen aufgenommen worden. Wenn guter Rat so teuer ist, wenn Unsinn nicht als Relikt von Unwissen, sondern als lebenssinnstiftende Kraft und tapferer Kampf gegen das Böse daherkommt, dann sind auch halbherzige Appelle, über dem Mitgefühl für die neuen Krankheiten doch auch die Vernunft sprechen zu lassen, willkommen. Ob höfliche Vermittlungsversuche zwischen den Krankenbewegungen, den Sekten, ihren Agenten und Lobbys auf der einen Seite und unserer Fassungslosigkeit auf der anderen überhaupt möglich sind, kann indes bezweifelt werden.
Showalter ist eine prominente Literaturwissenschaftlerin, Medizinhistorikerin und bekennende Feministin und hat auf all diesen Gebieten schon Erfahrungen gesammelt, wie mit Renegaten und Verräterinnen verfahren wird. Ihr Bekenntnis zu einem rationalen Feminismus, der ein Kind der Aufklärung sei, klingt etwas dünn. Denn die neuen Kranken sind nicht nur ganz überwiegend Frauen; die Krankheiten selbst, gerade die destruktivsten, haben ihren Nährboden im Feminismus, den in einen irren und einen vernünftigen zu sortieren noch nicht geglückt ist. Im unklaren läßt Showalter uns auch darüber, was sie unter einer feministischen Therapie im guten Sinn versteht; die schlichte Eroberung der psychosozialen Berufsfelder durch immer mehr Frauen kann damit ja nicht gemeint sein. Boshafte Menschen könnten gerade in diesem Konzept die Wurzel des fatalen Zusammenspiels von Patientinnen und Therapeutinnen sehen, welches die Empathie für die Kranken in Parteinahme für eine höhere Sache außerhalb des Sprechzimmers verwandelt.
Der Feminismus der Mittelklasse ist ein Kind der Kulturwissenschaft gewesen, lange bevor die Philologen sich unter diesem neuen Dach versammelten. Auch Showalters schönste Funde und Deutungen entrücken und ästhetisieren Probleme, die wir uns als "Hystorien" vielleicht in hundert Jahren post festum zur Lehre werden lassen können. Angesichts schauriger Gerichtsprozesse und der Vergiftung des Klimas für Kinder, Jugendliche, Ehepartner und Familien benötigen wir eine weniger distanzierte, handfeste Aufklärung. Es fehlt Showalter, anders gesagt, am harten Training in Soziologie und Politik.
Ihr Buch ist sehr ungleichgewichtig. Die ersten beiden Kapitel sind eine Art Zitatenreise durch die Hysterieforschung und die aktuelle Freud-Kritik. Der dritte Teil befaßt sich dann mit den psychischen Epidemien, die manchem heute so viele Sorgen machen wie den aufgeweckten Zeitgenossen um 1930 der Antisemitismus. Showalter behauptet, daß auf dem Grund dieser Epidemien vom Golfkriegssyndrom bis zur Mythenbildung um "rituellen Mißbrauch" das kulturelle Verbot steht, psychische Leiden so ernst zu nehmen wie physische.
Als roter Faden, als ein Vermittlungsangebot zwischen Kranken, parteiischen Helfern und den Vernünftigen und Bestürzten, durchzieht Showalters Buch der Versuch, das Mitleid walten zu lassen, das Verständnis für jedweden Unfug, der irgendwie ausgelebt wird. Ihr fehlt der Sinn für die Verknüpfung von Leid und Lobby, wie sie vor vielen Jahren Barbara Nelson in der Analyse der Kindesmißhandlung vorgeführt hat. Sie hat auch keine Ahnung von dem, was in Psychoanalytikerkreisen als sekundärer Krankheitsgewinn gefürchtet wird. Wer von einem Therapeuten oder einem Moderator im Fernsehen ermuntert wird, sein Unglück auf Mißbrauch in der Kindheit oder andere konkrete Ereignisse zurückzuführen, der ist nicht mehr heilbar und wird seine Zukunft in Betroffenenkreisen und angeschlossenen Vereinen suchen müssen. Immerhin eine Alternative zum Briefmarkensammeln.
Weil Showalter die Bedeutung der Kultur überschätzt und politisch und soziologisch naiv ist, kann sie die "Multiple Persönlichkeit" und das Golfkriegssyndrom unter einen Hut bringen. Unfreundliche Leser könnten behaupten, daß das Leiden der Kriegsneurotiker für Showalter dazu herhalten muß, die feministisch induzierten Neurosen durch den Nachweis zu legitimieren, daß unsere Zeit auch Männer deprimiert. Das Golfkriegssyndrom ist aber ein Resultat aus der Zivilisierung der Armee und dem Versagen der öffentlichen Krankenversorgung in den Vereinigten Staaten. Nur wer handfeste Verletzungen plausibel machen kann, hat Anspruch auf Entschädigung. Davon abgesehen dürfte jeder moralisch integre junge Mann heutzutage Probleme damit haben, im Krieg zu sein, töten zu müssen und mit der Angst zu leben, selbst zu sterben.
Georges Didi-Hubermans Rhapsodie über die Erfindung der Hysterie durch die Fotografen der Salpetrière unter der Regie von Charcot hat Showalter wohl nicht gekannt. Das Buch ist in Frankreich schon 1982 erschienen und wird erst jetzt, vielleicht zum richtigen Zeitpunkt, deutschen Lesern vorgelegt. Didi-Huberman ist Kunsthistoriker - kein Psychiater, Psychologe oder Politiker - und vertieft sich rückhaltlos in das Durcheinander von Leiden, Kunst, Bild und Macht. Bei ihm hätte Showalter lernen können, daß die Fixierung auf das Trauma, die reale Verletzung, in die Irre führt. Sie hätte auch lernen können, daß im Doppel von Arzt und Patientin nicht immer die Patientin den kürzeren zog. Die berühmte, von den Surrealisten fünfzig Jahre später gefeierte Augustine entzog sich den männlichen Nach- und Hilfestellungen durch die Flucht. Die Hysterikerin par excellence, festgehalten in zahlreichen Bildern, entschwand ins Nichts.
Elaine Showalter: "Hystorien". Hysterische Epidemien im Zeitalter der Medien. Aus dem Amerikanischen von Anke Caroline Burger. Berlin Verlag, Berlin 1997. 319 S., geb., 39,80 DM.
Georges Didi-Huberman: "Erfindung der Hysterie". Die photographische Klinik von Jean-Martin Charcot. Aus dem Französischen von Silvia Henke, Martin Stingelin und Hubert Thüring. Wilhelm Fink Verlag, München 1997. 383 S., Abb., br., 58,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main