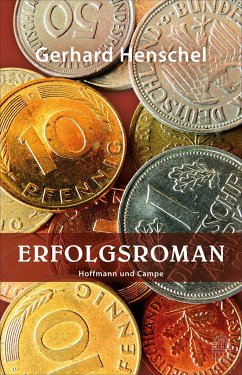Sie zog Das Kapital aus dem Regal. 'Hab ich auch mal zu lesen versucht. Schön und gut, aber irgendwie hätte ich gedacht, es müssten mehr Indianer drin vorkommen ...'
Die junge Frau, die sich für Marx interessiert, ist die Anglistikstudentin Kathrin Passig aus Regensburg. Martin Schlosser lernt sie Anfang der neunziger Jahre als Gewinnerin eines von ihm selbst organisierten Preisausschreibens für das Satiremagazin Kowalski kennen. Dort ist er inzwischen als freier Mitarbeiter tätig. Und weil auch der Merkur, die Frankfurter Rundschau und konkret seine Texte drucken, kann er endlich vom Schreiben leben. Von nun an steht er nicht mehr hinter dem Tresen einer friesischen Rumpeldiscothek, sondern geht als Reporter auf Reisen: etwa zu einem Jonglierfestival in Oldenburg, zur Wiedervereinigungsfeier vor dem Berliner Reichstag oder zu einem Atheisten-Kongress in Fulda. Nebenbei kümmert er sich um seine Großmutter in Jever, besucht hin und wieder seinen Vater in Meppen oder tummelt sich auf Tantra-Workshops. Dann zieht es ihn wieder nach Berlin. Alles wendet sich jetzt, wie es scheint, zum immer Besseren: Verleger bieten ihm Buchverträge an, es gibt Einladungen zu Lesungen, die Nächte werden länger, und das Leben ist schön.
Die junge Frau, die sich für Marx interessiert, ist die Anglistikstudentin Kathrin Passig aus Regensburg. Martin Schlosser lernt sie Anfang der neunziger Jahre als Gewinnerin eines von ihm selbst organisierten Preisausschreibens für das Satiremagazin Kowalski kennen. Dort ist er inzwischen als freier Mitarbeiter tätig. Und weil auch der Merkur, die Frankfurter Rundschau und konkret seine Texte drucken, kann er endlich vom Schreiben leben. Von nun an steht er nicht mehr hinter dem Tresen einer friesischen Rumpeldiscothek, sondern geht als Reporter auf Reisen: etwa zu einem Jonglierfestival in Oldenburg, zur Wiedervereinigungsfeier vor dem Berliner Reichstag oder zu einem Atheisten-Kongress in Fulda. Nebenbei kümmert er sich um seine Großmutter in Jever, besucht hin und wieder seinen Vater in Meppen oder tummelt sich auf Tantra-Workshops. Dann zieht es ihn wieder nach Berlin. Alles wendet sich jetzt, wie es scheint, zum immer Besseren: Verleger bieten ihm Buchverträge an, es gibt Einladungen zu Lesungen, die Nächte werden länger, und das Leben ist schön.