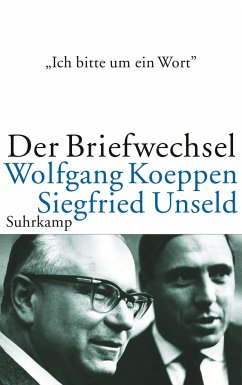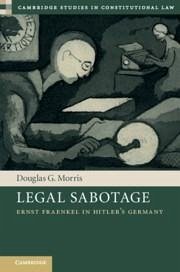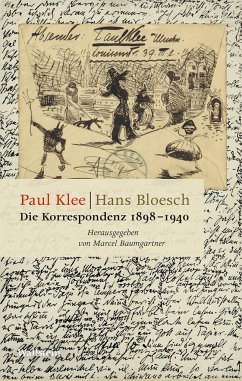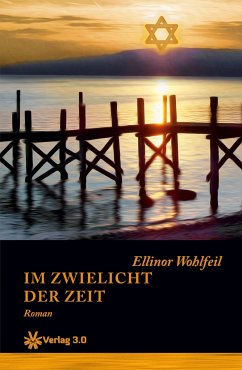Nicht lieferbar
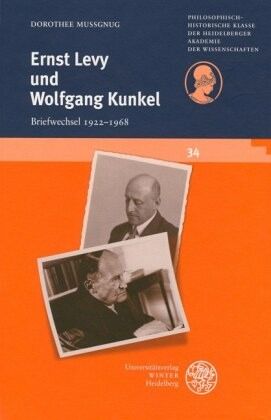
Ernst Levy und Wolfgang Kunkel
Briefwechsel 1922-1968. Vorgel. am 9. Juli 2004 v. Adolf Laufs
Herausgegeben: Mußgnug, Dorothee
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Die Korrespondenz der beiden Juristen umfaßt etwa 550 Briefe. Sie beginnt 1922, als Kunkel seinen Lehrer um Ratschläge für seine Dissertation bat, und endet 1968 mit Levys Tod, als der Lehrer nicht nur zum Kollegen sondern zum vertrautesten Freund geworden war. Levy antwortete Kunkel aus Freiburg, aus Heidelberg, aus Seattle (Washington), aus Basel und zuletzt aus Davis (Calif.). Beide bewahrten die Briefe von Anbeginn an sorgfältig auf. Von der Zwangspause während des Zweiten Weltkrieges abgesehen blieben sie immer in direktem Kontakt. Die schwierigen Lebensbedingungen eines Emigranten, ...
Die Korrespondenz der beiden Juristen umfaßt etwa 550 Briefe. Sie beginnt 1922, als Kunkel seinen Lehrer um Ratschläge für seine Dissertation bat, und endet 1968 mit Levys Tod, als der Lehrer nicht nur zum Kollegen sondern zum vertrautesten Freund geworden war. Levy antwortete Kunkel aus Freiburg, aus Heidelberg, aus Seattle (Washington), aus Basel und zuletzt aus Davis (Calif.). Beide bewahrten die Briefe von Anbeginn an sorgfältig auf. Von der Zwangspause während des Zweiten Weltkrieges abgesehen blieben sie immer in direktem Kontakt. Die schwierigen Lebensbedingungen eines Emigranten, Remigranten und wieder in die Fremde Zurückgekehrten werden am Briefbestand deutlich: Kunkels Briefe an Levy haben mit den Umzügen zum Teil viermal den Ozean überquert, um schließlich wieder nach Heidelberg zu kommen. In den Briefen spiegeln sich die Lebens- und Arbeitsbedingungen in Deutschland während des Nationalsozialismus, in den USA, in Ost- und Westdeutschland nach dem Krieg. Sie sind eines der wenigen gut dokumentierten Zeugnisse einer Epoche, die allzuoft Bindungen zerriß.