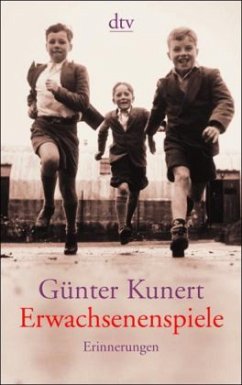Als Kind einer sogenannten "Mischehe" 1929 in Berlin geboren, muß Günter Kunert erleben, wie die Familie der jüdischen Mutter in Konzentrationslagern umkommt. Als aufmüpfiger junger Künstler in der DDR muß er mit ansehen, wie ein bürokratischer Unterdrückungsstaat die hohen Ideale des Sozialismus verrät. 1979 wird er gezwungen, sein Land zu verlassen. Mit bitterer Ironie und deftigem Sarkasmus betrachtet er hier die Stationen seines "deutschen" Lebens.
Günter Kunert erzählt auf tragikomische Weise sein »deutsches« Leben. Er beschreibt sein Berlin, in dem er zuerst den totalen Krieg und danach die totale DDR erlebt oder vielmehr überlebt. Das Buch ist so spannend, daß man es nur ungern aus der Hand legt, und daß es so ist, liegt sicher zum größten Teil daran, daß Kunert über seine Kindheit nicht jammernd oder hadernd berichtet, sondern sehr liebevoll an die Menschen erinnert, die ihn begleitet haben. Dabei verliert er den Zusammenhang zwischen der großen Geschichte und seinem privaten Universum nie aus den Augen. Bei all den liebenswürdigen und teilweise sehr heiteren Geschichten, an die sich Günter Kunert erinnert, vergißt man trotzdem nicht, was für Unfaßbarkeiten er da eigentlich beschreibt.
Besser, authentischer und trotzdem unterhaltend kann man die neuere deutsche Geschichte kaum erzählen.
Günter Kunert erzählt auf tragikomische Weise sein »deutsches« Leben. Er beschreibt sein Berlin, in dem er zuerst den totalen Krieg und danach die totale DDR erlebt oder vielmehr überlebt. Das Buch ist so spannend, daß man es nur ungern aus der Hand legt, und daß es so ist, liegt sicher zum größten Teil daran, daß Kunert über seine Kindheit nicht jammernd oder hadernd berichtet, sondern sehr liebevoll an die Menschen erinnert, die ihn begleitet haben. Dabei verliert er den Zusammenhang zwischen der großen Geschichte und seinem privaten Universum nie aus den Augen. Bei all den liebenswürdigen und teilweise sehr heiteren Geschichten, an die sich Günter Kunert erinnert, vergißt man trotzdem nicht, was für Unfaßbarkeiten er da eigentlich beschreibt.
Besser, authentischer und trotzdem unterhaltend kann man die neuere deutsche Geschichte kaum erzählen.

"Erwachsenenspiele": Günter Kunert hat seine Erinnerungen geschrieben · Von Jochen Hieber
Am 17. Juni 1953 ist der vierundzwanzig Jahre alte Dichter Günter Kunert fast euphorisch gestimmt. Auch daß die Demonstranten am Alexanderplatz, unter die er eher zufällig geraten ist, vom Polizeipräsidium aus beschossen werden, ficht ihn kaum an. Wer die Berliner Bombennächte des Zweiten Weltkriegs überstand, dessen ist er gewiß, wird nun nicht untergehen. Deckung suchen, zur rechten Zeit aus dem Schußfeld rennen und dann "gemächlich" seiner Wege gehen: "Ein Junispaziergang einmaliger Art". Er führt den jungen Mann durch leere Straßen abseits des Zentrums und allmählich wieder zurück nach Berlin-Treptow, wo er wohnt. Marianne, seine Frau, kann mit guter Nachricht aufwarten: Der Polsterer ist gekommen und hat die alte Couch erneuert. "Am Radio verfolgen wir, wie der Aufruhr niedergewalzt wird."
Am 13. August 1961 erscheint bei den Kunerts ein völlig verzweifelter Freund. Frau und Kinder, erzählt er, seien tags zuvor in den Westen gegangen, er habe ihnen nachreisen wollen, nun aber käme kein normaler Ostberliner mehr über die Grenze. Also fährt Kunert - er besitzt den Sonderausweis der Privilegierten, die "Grüne Karte" - am Tag des Mauerbaus von Treptow nach Tempelhof, um die Geflohenen zu trösten und ihnen weitere Kleider zu bringen. Anschließend wird in Heiligensee noch ein Heizlüfter abgeholt. Und dann? Sehenden Auges zurück in den Osten, "ins Jammertal von morgen", an dessen bessere Zukunft der Dichter im August 1961 indes noch glaubt: "Außerdem klebe ich auf der antifaschistischen Leimrute, flugunfähig, fluchtunfähig."
Das sehr Persönliche und das große Ganze, das ganz Private und der zeitgeschichtliche Augenblick: In diesen beiden Passagen finden sie - auf so bestürzende wie skurrile Weise - trefflich zusammen. Und solches Zusammentreffen, solchen Zusammenprall hat es im Lauf von Kunerts Leben vielfach gegeben. Während der Kindheit im nationalsozialistischen Berlin ist es die Herkunft, die ihn stigmatisiert und gefährdet: Die Mutter ist Jüdin. In der DDR ist es seine zunehmende Kompromißlosigkeit gegenüber Behörden und Verbänden, die ihn immer wieder in Konflikt mit der Staatsmacht bringt. Davon erzählen Kunerts "Erinnerungen".
Die Dichte und die Prägnanz, die bei der Schilderung des 17. Juni und des 13. August beeindrucken, wollen sich allerdings kaum noch einstellen. Das mag erstaunen bei einem Autor, dessen Kurz- und Kürzestgeschichten meist pointiert und stilsicher an ihr Ziel gelangen, dessen beste Gedichte sich keine sprachlichen Beliebigkeiten leisten. Günter Kunert indes ist ein Kurzstreckenkönig der Literatur. Kein Zufall, daß sich unter den vielen Büchern, die er seit 1950 veröffentlicht hat, nur ein Roman ("Im Namen der Hüte", 1967) befindet - und der darf als mißraten gelten. Die lange Erzähldistanz ist seine Sache nicht. Weshalb ihn genau jene Qualitäten, die seine Lyrik und seine Kurzprosa auszeichnen, im Memoirenband "Erwachsenenspiele" durchaus im Stich lassen.
Sprache und Stil des jüngsten Buchs sind eine mittlere Katastrophe. Grammatische Bezüge stimmen nicht: Mit Mißbehagen sieht man den jungen Kunert auf seinem Sitz in Brechts Berliner Ensemble, "von wo aus ich die Arbeit des Dompteurs mit den, zum Teil unwilligen, ihn Ausgelieferten beobachten kann". Die Zeitenfolge gerät aus den Fugen: "Als wir uns zum allerletzten Mal wiedersehen werden, überlagert Ernst den Spieltrieb", notiert er in einer Szene über einen Jugendfreund. Da werden Versuche unternommen, einer "Blondine Küsse zu applizieren", da strömen "Redeflüsse . . . sintflutartig hervor", da steht im Stadtzentrum eine Bank, die "unsere Hintern empfing".
Vor allem aber wird man fortgesetzt gequält mit dem Grundübel schlechter Texte, dem Nominalstil. Der Schüler Kunert hat ein "Pariser Nudistenblatt" ergattert. Die Zeitschrift ist an den Knickstellen brüchig, für Kunert weist sie "schon Brüchigkeit auf". Er verträgt keinen Alkohol, schreibt jedoch: "Meine Alkoholverträglichkeit war minimal." Besonders die "Inaugenscheinnahme" hat es dem Autor angetan: "Durch die aktuelle Inaugenscheinnahme", heißt es einmal, habe seine Frau ihre "Kindheitserinnerungen" beschädigt gesehen - die beiden haben das verlotterte Domizil einer Tante in Polen besucht. Der Exilant Kunert trifft 1979 in Den Haag auf einen Bürokraten, dessen stures Protokoll von einem unkonventionellen Abgeordneten flugs handschriftlich verbessert wird: "Nach des Beamten Wiedereintritt", erfahren wir, "stutzt der sekundenlang bei der Inaugenscheinnahme des Geschreibsels, behält jedoch die Contenance." Übrigens, wer stutzt hier? Der Wiedereintritt? Sicher ist nur, daß der Leser die Contenance verliert.
Nominalstil ist Bürokratenstil. Daß er sich ihm unterwirft, ist das wirkliche Unglück des Günter Kunert. Da hat er Jahrzehnte lang den Anfechtungen, den Nachstellungen der Stasi widerstanden - um nun nicht besser zu schreiben als die Spitzel, die ihn denunzierten. Man kann das nachprüfen. Denn deren Berichte werden ebenso seitenfüllend wiedergegeben wie die öden Elaborate willfähriger Germanisten gegen den Dichter. All dies, keine Frage, war für den Betroffenen schrecklich. Aber sollte seine Methode des ermüdenden Zitierens Schule machen bei Selbstbiographen, die zumindest einen Teil ihres Lebens in der DDR verbrachten, haben wir noch viel schlechte Prosa zu erwarten.
Ein ums andere Mal stand Günter Kunert im Zentrum von zermürbenden Konflikten, die Partei und Schriftstellerverband gerade den bekanntesten, auch den besten Autoren des Landes aufzwangen. Naturgemäß spielten deshalb etwa Johannes R. Becher und Bertolt Brecht, Christa Wolf und Stephan Hermlin, Stefan Heym und Peter Hacks, Heiner Müller, Wolf Biermann, Peter Huchel oder Sarah Kirsch nicht nur in seinem Alltag, sondern auch für seine literarische Arbeit und seine politische Haltung eine große Rolle. Selbstredend kommen sie in den "Erinnerungen" vor. Indes, sie bleiben, von Becher vielleicht abgesehen, als Figuren merkwürdig konturlos.
Bezeichnend dafür ist die Schilderung eines berühmten Abends im Spätherbst. Da treffen sich, im November 1976, bei Stephan Hermlin einige wichtige Autoren der DDR. Beraten wird eine Petition an die Regierung: Sie möge die Ausbürgerung Biermanns überdenken. "Was für dürftige Verschwörer sind wir gewesen", klagt Kunert im Rückblick. Über die Debatten selbst jedoch erfährt man wenig - und daß Volker Braun stärker sächselte als sonst, ist bloß ein kleines anekdotisches Dekor. Abfällig spricht der Autobiograph von Rolf Schneider, der ungebeten erscheint. Woher wußte er von der Versammlung? Hatte er einen Wink von der Stasi erhalten? Darauf gibt Kunert keine Antwort. Gibt es eine? Und wenn es keine geben sollte, warum suggerieren die Memoiren sie dann?
Es sei nicht verschwiegen, daß auf den fast 450 Seiten der "Erinnerungen" viel Lebensstoff entfaltet wird, der für sich allein Interesse verdient. Die Atmosphäre der Kriegs- und Nachkriegsjahre in Berlin ist zu spüren. Die ungeheure, für die Autoren meist fatale Bedeutung, die das DDR-Regime der Literatur beimaß, vermag Kunert am eigenen Fall zu beglaubigen: Bemerkenswert dabei, wie gerecht gerade die mächtigen Gegner, die Funktionäre Kurt Hager etwa oder Klaus Höpcke, vom Chronisten gezeichnet werden. Nirgends Larmoyanz zudem - und das Eigenlob erträglich. Berliner Witz, wenn es um den Erwerb des ersten Wartburg geht - "oben Eierschale, unten lichtes Anthrazit" -, wenn die Kuttelsuppe des Günter Grass Revue passiert oder die skurrile Momomanie des Philosophen Herbert Marcuse. Allein, es hilft nichts: Der Autor dieser Memoiren, die 1979 mit der Ausreise aus der DDR enden, ist erheblich bedeutender als sein jüngstes Buch.
Günter Kunert: "Erwachsenenspiele". Erinnerungen. Carl Hanser Verlag, München 1997. 447 S., geb., 49,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main