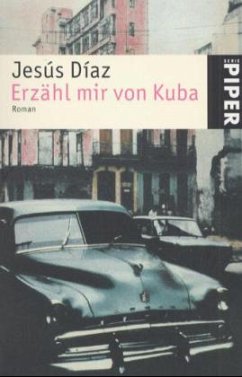Wehmütig läßt Stalin Martinez die Ereignisse der vergangenen Wochen Revue passieren, während er darauf wartet, daß ihm die unbarmherzige Sonne Miamis auf der Dachterrasse seines Bruders die Haut gerbt und ihm das Aussehen eines Bootsflüchtlings verleiht. Mit seinem neuen Kuba-Roman, der zärtlich und ironisch zugleich ist, trifft Diaz mitten ins Herz.

Wege zum Asyl: Jesús Díaz weiß um die Nöte von Exilkubanern
Im Kern ist Stalin ein guter Diener der Revolution. Doch als er die Augen nicht mehr davor verschließen kann, daß der Kommunismus sein privates wie berufliches Leben zugrunde richtet, vermag er den Verlockungen des Klassenfeinds nicht mehr zu widerstehen. Klammheimlich macht der Diktator sich aus dem Staub und beantragt in Miami Asyl.
Daß diese scheinbar apokryphe Biographie des Genossen Josef Wissarionowitsch ins Zentrum eines Romans von Kubas wohl angesehenstem Exilautor Jesús Díaz rückt, liegt nur an einer kuriosen Namenskoinzidenz: Stalin heißt weiter Martínez und wohnt in Casablanca; und Casablanca ist hier nicht die legendäre Stadt Humphrey Bogarts und Ingrid Bergmans, sondern ein heruntergekommener Vorort von Havanna.
Mit dem sowjetischen Diktator, nach dem ihn sein Vater aus Solidarität mit Moskau benannte, hat der dünnhäutige Zahnmediziner herzlich wenig gemeinsam. Eigentlich ist er schon zufrieden, solange er sich in seine Gebisse, Brücken und Füllungen versenken darf, ihn sein alter Ventilator namens Pepe, seine verrostete Drahteselin namens Fredesvinda und seine Frau namens Idalys nicht im Stich lassen und letztere ihm das regelmäßige "Schwapi-Schwapi" nicht versagt, womit sie die Ausübung der ehelichen Pflichten zu bezeichnen pflegt. Allein nicht einmal dieses bescheidene Glück ist ihm gegönnt. Da ein kubanischer Zahnarzt einen Hungerlohn verdient, muß er nachts als Kellner in einem Privatrestaurant aushelfen, während seine angetraute Kabarettänzerin das Schwapi-Schwapi einem Taxifahrer zugute kommen läßt.
Daß die Flucht von Havanna nach Little Havana Dr. Stalin keinen seiner Träume von Ruhm und einer eigenen großen Stomatologischen Klinik erfüllen wird, ist vorprogrammiert. Mit Stalin hat Jesús Díaz einen Prototypen des ewigen Verlierers geschaffen. Trotz aller Ironie gibt der Autor seine Figur dennoch in keinem Moment der Lächerlichkeit preis. Vielmehr entwickelt der vom Schicksal und seinen Unterentwicklungskomplexen gebeutelte Stomatologe Stalin in all seiner Mittelmäßigkeit eine große Glaubwürdigkeit, ja zuweilen Tragik.
Ohne eigenes Verschulden an der Perspektivlosigkeit des eigenen Landes gescheitert, ist Martínez auf dem besten Weg, auch in der neuen Heimat Amerika unters Rad zu kommen. Ob Diktatur des Proletariats oder der Finanzen - für den Exilanten bedeuten sie letztlich etwas Ähnliches: Selbstverleugnung und Illusionsverlust. Lenin Martínez, der stromlinienförmig angepaßte Bruder, wird von Stalin als Gewinnertyp beneidet, doch was will das heißen? Nach einer Funktionärslaufbahn kehrt Lenin der Partei und seinem Namen samt Patron den Rücken, um in Miami die steile Karriere als Pausen- und Kinderclown Leo anzutreten. Und Stalin? Nach Umtaufe in einen politisch korrekteren Estebán ist seine erste Erfahrung im selbsternannten Land der Freiheit und der Menschenrechte die selbstauferlegte Folter. Um als politischer Asylant anerkannt zu werden, muß der soeben einem Flugzeug Entstiegene rückwirkend in einen balsero verwandelt werden, in einen der zahllosen Flüchtlinge, die auf selbstgezimmerten Flößen die Straße von Florida überqueren. Auf der Dachterrasse von Lenin-Leos Haus harrt er so lange in der prallen Sonne aus, bis ihn Unterernährung und Verbrennungen dritten Grades zu einem glaubwürdigen Asylbewerber gemacht haben.
Anhand von Stalins Erinnerungen während dieser sechs Tage dauernden Gewaltkur läßt Díaz die Vergangenheit Revue passieren. Geradezu spiegelbildlich treten auf der Dachterrasse so Havanna und Miami, Kapitalismus und Kommunismus wie ein Diptychon einander gegenüber. Der Aufforderung "Erzähl mir von Kuba" kommt Díaz in einem umfassenden Sinn nach, der dem Regime in Havanna wenig schmeicheln dürfte: Angesichts der zwei Millionen über alle fünf Kontinente verstreuten Kubaner und einer zweiten Hauptstadt Miami, in der die englischsprachigen Einwohner immer mehr zur Minderheit werden, ist der Begriff "Kuba" nicht mehr in den Grenzen der karibischen Insel faßbar. "Erzähl mir von Kuba" erzählt auch vom kubanischen Exil. Doch anders als vielen exilkubanischen Autoren, etwa seiner Pariser Kollegin Zoé Valdés, fehlt Díaz jene bittersüße Mischung aus Emigrantennostalgie und Anklage gegen Castros Regime.
Nicht wegen der steten Verletzung der Menschenrechte verläßt Martínez die Insel, sondern weil er sich als hochqualifizierter Arzt keinen neuen Ventilator leisten kann und seine Frau dadurch verliert, daß er nicht einmal ein eigenes Auto hat. Die Banalität dieser Tatsache entspricht einer Wirklichkeit, die weder zum revolutionären noch zum konterrevolutionären Pathos paßt. So setzt sich Jesús Díaz zwischen alle Stühle; doch gerade dieser unbequeme, in der Luft hängende Sitz ist es, der Díaz während seines zehnjährigen Exils in Berlin und Madrid und als Herausgeber der Zeitschrift "Encuentro de la cultura cubana" zu einem der differenziertesten kubanischen Intellektuellen gemacht hat.
Der Roman bringt aber leider auch die Schattenseiten dieses politischen wie kulturellen Zwischenstadiums zum Ausdruck. "Erzähl mir von Kuba" oszilliert in befremdlicher Weise zwischen Havanna, Miami und Madrid, und bis zum Schluß ist nicht klar, für wen er eigentlich geschrieben ist: Auf der einen Seite handelt es sich um ein Werk der kubanischen Literatur, beschreibt Díaz eine Realität, die wohl nur von einem mit der Insel Vertrauten vollständig begriffen werden kann. Andererseits erzählt er mit dem Gestus des Reiseführers. Fast auf jeder Seite finden sich Erläuterungen zu "typisch kubanischen" Sachverhalten, ob es sich nun um die Geheimnisse der kreolischen Kochkunst, des tropischen Kommunismus oder des mit Afrikanismen getränkten Wortschatzes handelt. Skurrilerweise wirft so ein Kubaner einen touristisch gefärbteren Blick auf das eigene Land, als es über Kuba schreibende Ausländer - man denke nur an Hemingway - je wagten. Kubanismen treten sprachlich an die Seite von sich anbiedernden Modismen aus Madrid, die weder in Havanna noch in Miami etwas verloren haben. Daß sich der Roman auf deutsch dennoch flüssig liest, ist nicht zuletzt der Übersetzung von Klaus Laabs zu verdanken.
In seiner Vorbemerkung erklärt der Autor, die Geschichte sei ursprünglich als Drehbuch für einen nicht realisierbaren Film geplant gewesen. Was das Recyclingprodukt, den Roman, betrifft, wird man den Verdacht nicht los, Díaz habe sein Filmtreatment noch rasch verwerten wollen, bevor eine bereits überschwappende Kuba-Welle in Europa endgültig abebbt. Darauf verweist die unverhohlen auf ein spanisches Leserpublikum ausgerichtete Machart ebenso wie der im Vergleich zu Díaz' früheren Werken wie "Die Haut und die Maske" oder "Die Initialen der Erde" recht marktschreierisch anmutende Titel.
FLORIAN BORCHMEYER
Jesús Díaz: "Erzähl mir von Kuba". Roman. Aus dem Spanischen übersetzt von Klaus Laabs. Piper Verlag, München 2001. 303 S., geb., 39,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main