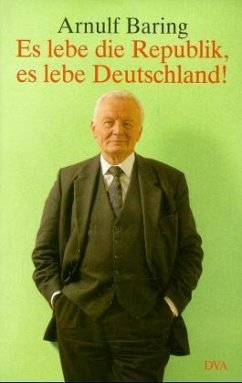Baring feiert Deutschland, aber Achtundsechziger müssen leider draußen bleiben
Arnulf Baring: Es lebe die Republik, es lebe Deutschland. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1999. 348 Seiten, 39,80 Mark.
"Wir sollten auch die deutsche Demokratie symbolisch zu überhöhen suchen", schreibt Arnulf Baring. Seine Überlegungen kreisen um die Beobachtung, dass sich jede Gemeinschaft ihrer selbst versichere, indem sie - Baring zitiert György Konrad - "ruhmreiche Anekdoten und Erinnerungen an gemeinsame Leiden" teile. Dieses Bedürfnis, "vom gemeinsamen Selbst gelegentlich ergriffen zu sein", werde in Deutschland nicht befriedigt, weshalb es seine Aufgabe und die seiner Generation sei, "vor ihrem Verschwinden" dazu beizutragen, "das Bild Deutschlands und der Deutschen zurechtzurücken, das die 68er verzerrt haben". Und genau das versucht Baring.
Der alte Konflikt um "68" liefert die Perspektive für Barings Argumentation. Doch wer in dieser Zeit noch ein Kind war, wer in "68" ein historisches Ereignis mit gewichtigen Folgen - ähnlich der Mondlandung - sieht, der kann die Schärfe einiger Äußerungen nur schwer nachvollziehen. Zudem verhindert Baring damit von vornherein, dass eine breite Mehrheit der Deutschen von dem hier beschriebenen Deutschland ergriffen sein könnte. Trotzdem bleibt das Buch überaus lesenswert. Denn mit der Frage nach nationalen Symbolen und vielleicht sogar demokratischen Mythen werden sich die Deutschen beschäftigen müssen.
In der Nachbemerkung schreibt Baring bescheiden, das Buch enthalte "Mutmaßungen" und "Andeutungen"; doch bietet es mehr als das, weil Baring skizziert, wie ein demokratischer Mythos beschaffen sein könnte. Zu diesem Zweck bedient er sich aus seiner eigenen Biographie und seiner wissenschaftlichen Arbeit. Bis auf das Schlusskapitel sind alle Texte schon einmal veröffentlicht worden. Gemäß der Chronologie der Ereignisse reihen sich Auszüge aus zentralen Arbeiten ("Machtwechsel", "Außenpolitik in Adenauers Kanzlerdemokratie") und politische Aufsätze, autobiographische Texte sowie ein Essay, in dem Baring das wertende Gerüst entwickelt, aneinander. Der persönliche Ton vieler Texte strahlt auch auf die nüchternen Analysen aus, was nicht störend wirkt. Im Gegenteil, die überall zu spürende Präsenz des Menschen Baring als teilnehmender Beobachter der vergangenen Jahrzehnte erweist sich als eindrucksvoller Kunstgriff.
Auf 270 Seiten entsteht aus den Einzeltexten eine auf potenziell sinn- und einheitsstiftenden Ereignissen fußende Geschichte der zweiten deutschen Republik. Barings Blick folgend, bleiben die Ereignisse keine trockenen Fakten, sie werden lebendig: das Attentat auf Hitler, die Bombardierung Dresdens, das Kriegsende, der Wiederaufbau, Adenauer, die Luftbrücke als Symbol für die Verlässlichkeit der Amerikaner, der Aufstand 1953, die Westbindung, der Machtwechsel 1969 und die Wiedervereinigung. Die Daten werden zu einer Erfolgsgeschichte und, als Panorama betrachtet, zum Zeichen für die vergangenen Jahrzehnte, einem Zeichen, dem die Leidenschaft des Autors die Aura verleiht. So wie Baring von Deutschland und der Bundesrepublik erzählt, so müsste ein demokratischer Mythos inszeniert werden. So müsste es klingen, wenn man von Deutschland spricht.
Doch da Baring ernst genommen wird und werden will, muss er sich fragen lassen: Wo haben die Linken im Mythos Deutschland ihren Platz, sieht man von den nicht besonders weit links im politischen Spektrum anzusiedelnden Brandt, Schmidt und Wehner ab? Baring beschäftigt sich vor allem mit jenen, die er "die 68er" nennt. Es handle sich um eine Generation, die "immer nur Aufstieg, Wohlstand, wachsende Lebenschancen wahrgenommen, für selbstverständlich gehalten" habe. Darin sieht er auch den Grund, dass viele "68er" mit der heutigen Realität Schwierigkeiten hätten, weil es "zwischen dem, was sie als junge Leute für relevant, für eine angemessene Beschreibung der Wirklichkeit, für entsprechende Handlungsimperative gehalten haben, und den heutigen Realitäten . . . gewaltige Unterschiede" gebe. Und schließlich wirft er ihnen vor: "Es waren die 68er, die selbstgerecht und pauschal alles, was vor ihrer Zeit gewesen war, dem Faschismus zurechneten, erst mit der Ankunft ihrer eigenen Generation Demokratie, Freiheit und Fortschritt gesichert glaubten." Die "Außerparlamentarische Opposition" und die spätere Partei der Grünen nimmt der Autor als Phänomen ernst, aber inhaltlich nicht für voll. Allein den Titel einer Jugendbewegung, die nach einer Heilserfahrung jenseits des Jenseits suchte und teilweise noch immer sucht, gesteht er ihnen zu. Sein Wohlwollen gilt allenfalls ihrem privaten Miteinander.
Jeder der Kritikpunkte hat Gewicht, und genug Belege dafür ließen sich finden. Doch war das alles, lassen sich "die 68er" auf diese Weise ausreichend beschreiben? Denn "68" hat eine soziale Revolution ausgelöst, die sich im Wort Emanzipation fassen lässt: nicht nur in den Familien, nicht nur im Miteinander der Geschlechter, sondern auch in den Schulen, in den Universitäten, im Berufsleben und in der Politik. Es entstanden nicht zuletzt neue Formen der politischen Meinungsäußerung, die inzwischen von allen Parteien genutzt werden. In den darauf folgenden Jahrzehnten gehörten Bürger aus dem Umfeld von "68" zu den maßgeblichen Personen, die Diskurse über die Nachhaltigkeit der Wirtschaft, die Umweltzerstörung und nicht zuletzt auch die Nutzung von Kernkraft vorantrieben. Das bleibt bestehen, auch wenn viele ihrer Antworten weder realitätstauglich noch mehrheitsfähig waren oder sind. So betrachtet sind Barings "68er" zumindest aktive Bürger dieser Demokratie. Und das könnte der Autor zum Teil seines demokratischen Mythos machen. Den "68ern", von denen Baring sagt, sie seien die in "der Breite der Gesellschaft" maßgebliche Generation, sie hätten die Macht und gäben den Ton an, baut der Autor keine goldenen Brücken zur kleinen Ruhmeshalle der deutschen Demokratie.
Im abschließenden Essay beschränkt sich der Autor nicht darauf, seiner Skizze die ordnende und wertende Klammer zu geben. Er analysiert und kritisiert en passant die deutsche Außenpolitik und die Arbeit der rot-grünen Bundesregierung bis in dieses Frühjahr hinein. Anlass genug bietet sich zweifellos. Doch wie passt diese Kritik in den übrigen Text? Demokratische Mythen sollen Einheit und Sinn stiften. Die Tagespolitik dagegen lebt vom Meinungsunterschied, Streit und gelegentlicher Polemik. Dass diese unterschiedlichen Charakteristika zunächst nicht auffallen, liegt daran, dass Baring den "68ern" schon im Mythos Bundesrepublik keine besonders wohlwollende Bewertung zuteil werden lässt.
Den grundsätzlichen Widerspruch löst das gleichwohl nicht auf. Baring schwärmt von der Inszenierung der Demokratie, wie er sie in Frankreich oder Amerika erlebt hat, und schildert, wie sehr ihn das Selbstbewusstsein, der aristokratische Habitus, die Hingabe und das Pathos, mit denen sich der demokratische Staat dort feiert, beeindruckt haben. Ein nicht zu unterschätzender Grund für die hohe Integrationskraft der jeweiligen nationalen Mythen und Symbole ist aber, dass sie einen Minimalkonsens markieren, der eine überwiegende Mehrheit der Bürger anspricht. Der Konsens hat sich über die Jahrhunderte hinweg gebildet, sich entwickelt und verändert. Diese Festigkeit fehlt Deutschland als "verspäteter Nation", der erst 50 Jahre alten Bundesrepublik viel mehr. Zudem sollte niemand vergessen, dass über nationale Mythen - auch wenn es demokratische sind - erst seit wenigen Jahren nachgedacht wird (werden darf). Der harsche Umgang des Autors mit der "linken" Hälfte der Republik einerseits und sein ausdrücklicher Wunsch andererseits, Deutschland brauche einen einheitsstiftenden Mythos, führt zum Bruch: Ein befriedigender und befriedender Minimalkonsens kann auf diese Weise nicht entstehen.
GÖTZ HAMANN
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main