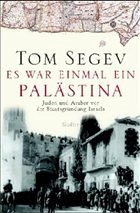Brandherd Palästina: Der Konflikt zwischen Arabern und Juden um die Herrschaft im Heiligen Land ist seit Jahrzehnten ungelöst. Tom Segev, Historiker und Journalist von internationalem Rang, zeigt, wie es dazu kam.
Aus einer Fülle bislang unerschlossener Quellen rekonstruiert Segev eine dramatische Ära grenzenloser Möglichkeiten und tragischer Fehlentscheidungen: die so genannte Mandatszeit von 1917 bis 1948, als nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches die Briten die Macht in Palästina ausübten und verhängnisvollerweise sowohl Arabern als auch Juden das Land versprachen. Er macht uns mit so legendären Figuren wie Lawrence von Arabien, General Allenby, König Faisal, Chaim Weizmann und David Ben-Gurion, aber auch mit einer bunten Mischung von Pionieren, Einwanderern, Abenteurern, Geheimagenten, Diplomaten und Fanatikern bekannt.
Segev zeichnet die Entstehung zweier Nationalbewegungen nach, ihren unaufhaltsamen Weg in die gewaltsame Konfrontation und kommt zu einer radikalen Neubeweg der britischen Mandatsmacht. Anstatt pro-arabisch, wie gemeinhin angenommen, hätten die Briten tatsächlich konsequent prozionistisch gehandelt - aus der antisemitischen Überzeugung heraus, die Juden drehten das Rad der Geschichte.
Aus einer Fülle bislang unerschlossener Quellen rekonstruiert Segev eine dramatische Ära grenzenloser Möglichkeiten und tragischer Fehlentscheidungen: die so genannte Mandatszeit von 1917 bis 1948, als nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches die Briten die Macht in Palästina ausübten und verhängnisvollerweise sowohl Arabern als auch Juden das Land versprachen. Er macht uns mit so legendären Figuren wie Lawrence von Arabien, General Allenby, König Faisal, Chaim Weizmann und David Ben-Gurion, aber auch mit einer bunten Mischung von Pionieren, Einwanderern, Abenteurern, Geheimagenten, Diplomaten und Fanatikern bekannt.
Segev zeichnet die Entstehung zweier Nationalbewegungen nach, ihren unaufhaltsamen Weg in die gewaltsame Konfrontation und kommt zu einer radikalen Neubeweg der britischen Mandatsmacht. Anstatt pro-arabisch, wie gemeinhin angenommen, hätten die Briten tatsächlich konsequent prozionistisch gehandelt - aus der antisemitischen Überzeugung heraus, die Juden drehten das Rad der Geschichte.

Die Folgen der britischen Mandatszeit für den Nahost-Konflikt
Tom Segev: Es war einmal ein Palästina. Juden und Araber vor der Staatsgründung Israels. Aus dem Amerikanischen von Doris Gerstner. Siedler Verlag, München 2005. 669 Seiten, 28,- [Euro].
Tom Segev, bekannter Kolumnist des "Ha'aretz" und ausgewiesener Zeithistoriker, hat ein anschauliches und spannendes Buch verfaßt. Der Untertitel "Juden und Araber vor der Staatsgründung Israels" verkürzt allerdings, weil die Politik der Mandatsmacht und ihrer Akteure in London und im Nahen Osten ebenso ausführlich geschildert und analysiert wird wie diejenige der beiden Hauptwidersacher. Das gegenseitige Beziehungsgeflecht ist nicht zuletzt deshalb so komplex, weil die drei "Gruppen" jeweils in sich partiell inkohärent waren und rivalisierend oft gegensätzliche Konzepte verfolgten. Die eingehende Darstellung bezieht nicht nur die maßgeblichen Politiker, Militärs und Spitzenbeamten ein, sondern sie schöpft immer wieder auch aus Tagebüchern und Briefen von Privatpersonen ohne Entscheidungsbefugnis, die manchmal unbefangener und amüsanter wirken. Sogar erotische Verbindungen zwischen Angehörigen der drei Seiten werden ausgebreitet. Das lockert zwar auf, führt jedoch gelegentlich in die Länge.
Wie in seinem Buch "Die Siebte Million" stellt Segev - zuspitzend, fast genüßlich - gern "Mythen" in Frage und bloß. An denen mangelt es in der Geschichte des Zionismus und des Panarabismus bekanntlich nicht. Das hat dem Werk in der jüdischen Welt naheliegenderweise auch Kritik eingetragen. Man gewinnt bei der Lektüre aber nicht den Eindruck, daß der Autor, wie gelegentlich behauptet, ein Post- oder gar ein Antizionist ist. Im Gegenteil: Er macht die imponierende geschichtliche Leistung der Zionisten in dieser entscheidenden Phase deutlich. Daran ändert nichts, daß er bewußt alle Seiten zu Wort kommen läßt. Bei der genauen Schilderung des grausamen Massakers an den Juden Hebrons 1929 weist er etwa darauf hin, daß es sich um "kein Pogrom im historischen Sinne" gehandelt habe und daß es einem "Gefühl der Angst und des Hasses" entsprang. Zudem betont er, daß Juden von Arabern versteckt und gerettet worden seien.
Die britische Mandatspolitik stellt Segev als von vorneherein konzeptionslos und zum Scheitern verurteilt dar, da sie - mit der Balfour-Erklärung einerseits und den sogenannten McMahon-Briefen andererseits - auf sich widersprechenden Zusagen an zwei Kontrahenten beruhte, daß ihnen das Land gehören solle. Da ein binationaler Staat keine Chance hatte, erwies sich das Dilemma als ausweglos und führte dann zwangsläufig zur Teilung, zum Abzug der Engländer im Chaos und zum Krieg. Immer wieder ist davon die Rede, daß man britischerseits - fälschlich - von der Macht der Juden in der Welt, besonders in den Vereinigten Staaten, ausging. Gern insinuierte es auch Chaim Weizmann, der auf die Londoner Politik zeitweise erstaunlichen Einfluß ausübte. Das nach wie vor verbreitete Klischee gilt seit längerem als antisemitisch.
Das Buch verdeutlicht, wie sehr Entwicklungen und Ausprägungen der Mandatszeit noch heute für Israel Relevanz besitzen, etwa der "neue Mensch" oder - sehr wesentlich - die Solidarisierung von "Tauben" und "Falken" durch den arabischen Terrorismus; sogar ein Sicherheitszaun an der nördlichen Grenze wurde damals bereits gebaut. Es räumt mit dem allgemein verbreiteten Mythos auf, der Staat Israel schulde seine Existenz vor allem der Schoa. Obgleich es die aus arabischen Bildungsdefiziten und Rückständigkeiten herrührende Problematik einvernehmlicher Lösungen verdeutlicht, läßt sich daraus noch keine Skepsis hinsichtlich des derzeitigen Friedensprozesses ableiten.
Segev hebt hervor, daß der Zionismus den europäischen Juden "in der Zeit der höchsten Not nur eine völlig unzureichende Lösung anbieten konnte". Er meint, die Ermordung von Chaim Arlosoroff im Sommer 1933 sei "nie aufgeklärt" worden. Jedoch spricht nunmehr vieles dafür, daß Joseph Goebbels dahintersteckte, mit dessen Frau Magda der Vorsitzende der Zionistischen Exekutive als Schüler in Berlin eng befreundet gewesen war; nach der "Machtergreifung" hatte Arlosoroff sogar versucht, mit ihr in Kontakt zu treten.
Instruktiv ist die Schilderung des Gesprächs zwischen dem aus Jerusalem geflüchteten Mufti und Hitler im November 1941 in Berlin. Schade, daß Segev bei der Schilderung der Vorgeschichte dieses Treffens nicht auf eine These des israelischen Historikers Isaiah Friedman in dem 1977 erschienenen Werk "Germany, Turkey and Zionism 1897-1919" eingeht. Demnach habe die deutsche Reichsregierung verhindert, daß die Türkei der jüdischen Gemeinschaft Palästinas im Ersten Weltkrieg das gleiche schlimme Schicksal bereitete wie den Armeniern.
NIELS HANSEN
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Für Lorenz Beckhardt ist Tom Segevs Buch nicht die erste, aber eine äußerst "lebendige" und "gut lesbare" Darstellung Israels vor der eigentlichen Staatsgründung im Jahre 1948, die sich durchaus als Standardwerk empfehlen kann. Segev zeige die politischen Akteure "in persönlichen Begegnungen, privaten Erlebnissen und mit ihren inneren Monologen". Das macht die Ausführungen "äußerst anekdotenreich, fast romanhaft" und verknüpfe sie eng mit den Akteuren wie etwa Chaim Weizmann, dem Chemiker und Zionisten mit besten Verbindungen ins politische Establishment Großbritanniens und späteren Staatspräsidenten Israels. Keineswegs aber, versichert Beckhardt, schreibt diese Form erzählender Geschichte altbekannte Mythen zu Israels Staatsgründung fort oder fügt gar neue hinzu. Im Gegenteil. Der Autor gehöre zu jenen Historikern, die sich seit den 80er Jahren kritisch mit den nationalen Legenden ihres Landes auseinandersetzen, erklärt Beckhardt. Etwa mit jener, die Israels Gründung als alleinige Folge der Shoa bewertet - als hätte es die realistische Option eines jüdischen Staates "nicht lange vor den Nazis gegeben".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Tom Segev hat ein fabelhaftes, hoch aktuelles Buch geschrieben." DIE ZEIT