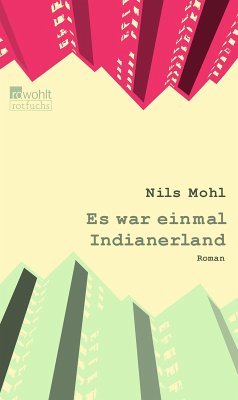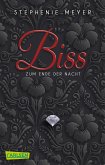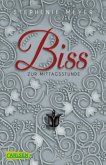Stell dir vor, du bist 17 und lebst in den Hochhäusern am Stadtrand. Der Sommer ist heiß. Es ist Mittwochnacht, als dir Jackie den Kopf verdreht. Im Freibad. Fuchsrotes Haar. Sandbraune Haut. Stell dir vor, wie dir die Funken aus den Fingern sprühen vor Glück. Und plötzlich fliegt die Welt aus den Angeln: Zöllner erwürgt seine Frau. Edda, die 21-Jährige aus der Videothek, stellt dir nach. Mauser steigt mit Kondor in den Ring. Immer wieder meinst du, diesen Indianer mit der Adlerfederkrone zu sehen. Und dann zieht zum Showdown ein geradezu biblisches Gewitter auf - fühlt es sich so an, erwachsen zu werden?
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Eine Hand
im Haar
Ein Junge aus der Vorstadt
probt Leben
Irgendwo muss das Meer sein“, weiß der Held von Nils Mohls Roman Es war einmal Indianerland, aber wie er da hinkommen könnte, weiß er nicht. Er ist erst siebzehn, er hat kein Auto, er hat kein Geld. Wo er lebt, stehen die Hochhäuser, die den Stadtrand markieren; hier gehört er nicht hin, aber hier kommt er auch nicht weg. Er will zu einem Musikfestival an der Küste, um dort eine junge Frau zu treffen, aber er scheut zugleich vor dieser Tour zurück, denn es kann sein, dass diese schöne Jackie, deren rotbraune Haare ihn faszinieren, ganz andere Freunde hat, als er es ist, ältere und intellektuellere – und davor fürchtet er sich. Denn Jackie lebt in einer Villengegend, einerseits unerreichbar und andererseits zum Greifen nah, seit er sie bei einer verbotenen nächtlichen Party im Schwimmbad vor den Wachleuten gerettet hat. Zusätzlich verunsichert ihn aber auch, dass eine andere junge Frau ihm geradezu nachstellt, Ella heißt sie, jobbt im Videoshop, ist ein bisschen älter als er und schreibt ihm laufend Postkarten. Jackie ist das Traummädchen mit sandbrauner Haut, teurem Bikini und toller Figur; Ellas Vorzüge hingegen müsste er erst noch entdecken, die zeigen sich nicht in ihrer Garderobe.
Mauser heißt dieser Junge, der oft und intensiv mit sich selbst wie mit einem Gegenüber zu sprechen und zu streiten scheint. Der nicht weiß, was er will, und oft nicht sieht, was er alles bekommen könnte, wenn er weniger mit sich selbst ringen würde. Weil er Ambitionen als Boxer hat, trainiert er viel mit dem Langeisen und mit schweren Gewichten. Manchmal prügelt er sich mit Jungs aus den Cliquen, die in diesem Stadtviertel umher streifen; coole Sprüche und Gesten haben diese junge Männer einer wie der andere drauf, aber die meisten sind nicht so ehrgeizig wie Mauser, der auch das Abi schaffen will; die meisten sind auch nicht so uneins mit sich selbst.
Er kenne den Stadtrand ganz gut, hat Nils Mohl in einem Interview erklärt, der Stadtrand sei literarisch relativ unerschlossenes Gebiet, obwohl jeder damit eine konkrete, oft jedoch recht schlichte Vorstellung verbindet. Nils Mohl, der vor vier Jahren einen ersten bitterbösen und genauen Roman über das Leben eines Kassierers in einem Großkaufhaus veröffentlicht hat, hält sich in Es war einmal Indianerland mit diesen simplen Stereotypen nicht lange auf. Er zerlegt die Geschichte von Mauser und seiner aufreibenden Reise an die Küste, die sich in wenigen Ferientagen abspielt, in kleinste Partikel, löst sich von jeder chronologischen Erzählweise und auch von jedem traditionellen Schema eines Problemromans; er schafft statt dessen ein Mosaik von Vor- und Rückgriffen, das sich wie ein Spiegel dessen liest, was im Kopf von Mauser abläuft, wenn er sich zwischen den beiden Frauen und den Problemen in seiner eigenen Familie verheddert.
Sprunghaft und schnell wie die Stimmungsschwankungen des Helden bewegt sich der Roman vor und zurück. Die Sätze sind pointiert, oft zutiefst ironisch und erschaffen sich einen ganz eigenen Resonanzraum. Der Held ist selten bei sich selbst: „Eine Hand greift mir ins Haar. Ich stelle fest, es ist meine“, erklärt Mauser – und der Leser weiß: Richtig leben fühlt sich anders an. Wie man da jedoch hin gelangen könnte, muss noch geklärt werden. Nils Mohl liebt Konjunktiv-II- Motive, lässt sich in einem anderen Interview mit ihm nachlesen, also Geschichten, die nur im eigenen Kopf spielen, die auf die Frage „Was wäre wenn?“ antworten und den Blick auf das Hier und Jetzt komplett verbauen. Mit Es war einmal Indianerland hat er dieser Verwirrung eine beeindruckende Form gegeben. (Für junge Erwachsene) MICHAEL SCHMITT
NILS MOHL: Es war einmal Indianerland. Rororo 2011. 352 Seiten, 12,99 Euro. (Kranichsteiner Jugendliteratur-Stipendium. Auswahlliste zum Deutschen Jugendliteraturpreis.)
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
im Haar
Ein Junge aus der Vorstadt
probt Leben
Irgendwo muss das Meer sein“, weiß der Held von Nils Mohls Roman Es war einmal Indianerland, aber wie er da hinkommen könnte, weiß er nicht. Er ist erst siebzehn, er hat kein Auto, er hat kein Geld. Wo er lebt, stehen die Hochhäuser, die den Stadtrand markieren; hier gehört er nicht hin, aber hier kommt er auch nicht weg. Er will zu einem Musikfestival an der Küste, um dort eine junge Frau zu treffen, aber er scheut zugleich vor dieser Tour zurück, denn es kann sein, dass diese schöne Jackie, deren rotbraune Haare ihn faszinieren, ganz andere Freunde hat, als er es ist, ältere und intellektuellere – und davor fürchtet er sich. Denn Jackie lebt in einer Villengegend, einerseits unerreichbar und andererseits zum Greifen nah, seit er sie bei einer verbotenen nächtlichen Party im Schwimmbad vor den Wachleuten gerettet hat. Zusätzlich verunsichert ihn aber auch, dass eine andere junge Frau ihm geradezu nachstellt, Ella heißt sie, jobbt im Videoshop, ist ein bisschen älter als er und schreibt ihm laufend Postkarten. Jackie ist das Traummädchen mit sandbrauner Haut, teurem Bikini und toller Figur; Ellas Vorzüge hingegen müsste er erst noch entdecken, die zeigen sich nicht in ihrer Garderobe.
Mauser heißt dieser Junge, der oft und intensiv mit sich selbst wie mit einem Gegenüber zu sprechen und zu streiten scheint. Der nicht weiß, was er will, und oft nicht sieht, was er alles bekommen könnte, wenn er weniger mit sich selbst ringen würde. Weil er Ambitionen als Boxer hat, trainiert er viel mit dem Langeisen und mit schweren Gewichten. Manchmal prügelt er sich mit Jungs aus den Cliquen, die in diesem Stadtviertel umher streifen; coole Sprüche und Gesten haben diese junge Männer einer wie der andere drauf, aber die meisten sind nicht so ehrgeizig wie Mauser, der auch das Abi schaffen will; die meisten sind auch nicht so uneins mit sich selbst.
Er kenne den Stadtrand ganz gut, hat Nils Mohl in einem Interview erklärt, der Stadtrand sei literarisch relativ unerschlossenes Gebiet, obwohl jeder damit eine konkrete, oft jedoch recht schlichte Vorstellung verbindet. Nils Mohl, der vor vier Jahren einen ersten bitterbösen und genauen Roman über das Leben eines Kassierers in einem Großkaufhaus veröffentlicht hat, hält sich in Es war einmal Indianerland mit diesen simplen Stereotypen nicht lange auf. Er zerlegt die Geschichte von Mauser und seiner aufreibenden Reise an die Küste, die sich in wenigen Ferientagen abspielt, in kleinste Partikel, löst sich von jeder chronologischen Erzählweise und auch von jedem traditionellen Schema eines Problemromans; er schafft statt dessen ein Mosaik von Vor- und Rückgriffen, das sich wie ein Spiegel dessen liest, was im Kopf von Mauser abläuft, wenn er sich zwischen den beiden Frauen und den Problemen in seiner eigenen Familie verheddert.
Sprunghaft und schnell wie die Stimmungsschwankungen des Helden bewegt sich der Roman vor und zurück. Die Sätze sind pointiert, oft zutiefst ironisch und erschaffen sich einen ganz eigenen Resonanzraum. Der Held ist selten bei sich selbst: „Eine Hand greift mir ins Haar. Ich stelle fest, es ist meine“, erklärt Mauser – und der Leser weiß: Richtig leben fühlt sich anders an. Wie man da jedoch hin gelangen könnte, muss noch geklärt werden. Nils Mohl liebt Konjunktiv-II- Motive, lässt sich in einem anderen Interview mit ihm nachlesen, also Geschichten, die nur im eigenen Kopf spielen, die auf die Frage „Was wäre wenn?“ antworten und den Blick auf das Hier und Jetzt komplett verbauen. Mit Es war einmal Indianerland hat er dieser Verwirrung eine beeindruckende Form gegeben. (Für junge Erwachsene) MICHAEL SCHMITT
NILS MOHL: Es war einmal Indianerland. Rororo 2011. 352 Seiten, 12,99 Euro. (Kranichsteiner Jugendliteratur-Stipendium. Auswahlliste zum Deutschen Jugendliteraturpreis.)
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de