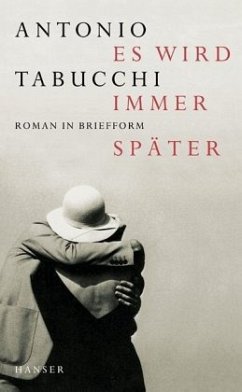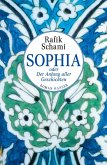Der neue Roman von Antonio Tabucchi, einem der meistgelesenen Autoren Italiens, hat wieder den wunderbaren "Tabucchi-Sound" und handelt von dem Spiel des Zufalls und der Liebe und der nicht einholbaren Vergangenheit. Es sind Geschichten voll ungestümer Phantasie und von großem sprachlichen Reichtum.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Antonio Tabucchis wehmütiger Briefroman / Von Dirk Schümer
Einen "Roman in Briefform" hätte Antonio Tabucchi sein neuestes Werk nicht unbedingt nennen müssen, denn es handelt sich um keinen Roman. Die Briefe, die hier versammelt sind, richten unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Geschichten an die verschiedensten Adressaten, und es sind einige wundervolle Briefe über die Liebe, die Sehnsucht und die Unmöglichkeit des Glücks dabei. Dennoch stellt die Rede vom Du, an den diese meist intimen Bekenntnisse gerichtet sind, keinen Zusammenhang her, weil es kein zuzuordnendes Ich gibt, dem das alles zugestoßen wäre. Tabbucchi hätte also ehrlicher von "Briefen" oder "Erzählungen" schreiben sollen, aber "Roman" klingt wohl irgendwie bedeutender, schwerergewichtig, endgültig.
Dabei zeichnet die besten der langen Briefe des Bandes gerade das Gegenteil aus, nämlich mit leichtem, melancholischem Ton fast beiläufig von den Katastrophen eines Lebens zu erzählen, die meist darin bestehen, daß der, der sie erlebt, sie kaum mitbekommt. Solche wie hingetuschten Biographien als Tragödien aufscheinen zu lassen - in dieser Kunst des wehen Prosagedichts ist Tabbucchi ein Meister. So handelt die vielleicht schönste Erzählung von einem jüdischen Harfenisten, der irgendwie der Vernichtung entkommen ist, der nach 1945 aus Italien weggeht, um zwischen Saloniki und Alexandria eine Existenz als anonymer Gelegenheits- und Barmusiker zu führen. Aber Tabucchi erzählt das natürlich viel lakonischer, wehmütig bis in die resignierten Bemerkungen am Rande, von Trauer erfüllt, gerade weil nicht von den Morden und Katastrophen im Großen die Rede ist, sondern von der Abendsonne über einer fremden Stadt und von Melodien, die nie mehr erklingen werden.
"Und darüber vergingen die Jahre": Solche und ähnliche Allerweltsüberleitungen wie aus Hebels oder Kleists Novellen machen geradezu den Kern von Tabucchis Ästhetik aus. Die Leben, die er von sich erzählen läßt, sind sich des Scheiterns und der Sinnlosigkeit bewußt. Die Augenblicke, in denen Nähe und Innigkeit möglich waren, sind verstrichen; der geliebte Mensch ist tot oder fort. Aus dieser Lage einen Brief zu schreiben ist eigentlich absurd, aber genau da beginnt die Literatur.
So sind Tabucchis beste Liebesbriefe vom Gefühl der Saudade, dem spezifisch portugiesischen Genuß an der Vergeblichkeit und der Unwiederbringlichkeit, durchzogen - eine Stimmung, die Tabucchi als herausragender Kenner der portugiesischen Literatur, Fernando Pessoas zumal, und des sehnlich-existentialistischen Fadogesangs nur zu gut zu evozieren und in die eigentlich luzideren Gefilde des italienischen Pessimismus zu transponieren weiß. So bekommen wir den lebensweisen Abschiedsbrief des Greises zu lesen, der über Jahrzehnte eine viel jüngere Frau begehrt hat, sie kurzzeitig als Geliebte erringen konnte und der weiß, daß sie nie mehr zu ihm zurückkommen kann. Aber er ist glücklich im einzigen Paradies, aus dem er nicht vertrieben werden kann: in der Erinnerung. Es ist die Erinnerung, das Selbstgespräch mit dem verblassenden Gedächtnis, das ihn seinen sinnlosen und gerade deshalb poetischen Abschiedsbrief schreiben läßt. Tabucchi kann auch böse sein, etwa wenn er einen verlassenen Ehemann, einen Arzt, einen Brief an seine Exfrau schreiben läßt, in dem er ganz maliziös zur Schau trägt, daß er vom Prostatakrebs des neuen Gefährten seiner Stetsgeliebten erfahren hat. Er malt sich und ihr das Leid seines Nachfolgers aus und bietet seinen Vorrat an Morphium an. Man kann froh sein, daß ein solcher Brief Fiktion ist. Aber in die eisige Tiefe eines verwundeten Herzens läßt er sehr wohl blicken.
So hätte man diesen Briefroman, der im Sinne von Choderlos de Laclos oder Werther keiner ist, wohl einen philosophischen Roman genannt, als es das Genre noch gab. Denn Tabucchis Prosa ist reich an zivilisationskritischen Detailbeobachtungen, etwa wenn er die Obszönität der Fernsehnachrichten in einigen angeekelten Sätzen über Unfalltote, sexy zurechtgemachte Ansagerinnen und verhungernde Kinder fokussiert. Neben tiefgreifenden Aussagen über den Rand des Universums, von wo eine Mutter Klopfrhythmen ihres verstorbenen Kindes zu empfangen glaubt, oder den Schmerz eines Manns nach dem Suizid der Frau treffen wir - anders wäre die Ballung schwer erträglich - immer auch auf trockene Bemerkungen über ein Rezept für Tagliatelle oder über familiäre Neurosen.
Der Autor, der mit dem "Indischen Nachtstück" und "Erklärt Pereira" zwei wundervolle Schicksalsromane vorgelegt hat und ja auch diesmal unbedingt einen Roman schreiben wollte, läßt sich jedoch zuweilen einfach gehen und extemporiert beispielsweise hemmungslos über Bellinis "Norma", läßt dabei seinen Assoziationen von italienischen Schlagern bis zu Sexualphantasien freien Lauf, bis der Leser den Eindruck von verwaschener, beliebiger Faselei bekommt, als würde die Welt bloß durch Milchglas beobachtet und solle dadurch besonders geheimnisvoll wirken. Das wird nicht besser durch das eitle Abschlußurteil, ein genialer Komponist wie Bellini sei nichts als ein braver Handwerker gewesen. Hier läßt sich Tabucchi, ohne an dieser Stelle Nennenswertes zu leisten, vom Hochmut der Moderne gegenüber würdigerer Ästhetik verleiten und fabuliert, verliebt in die Brillanz seines Stils und in seine Belesenheit, einfach drauflos.
In einem poetologischen Nachwort gibt Tabucchi freimütig an, manche Texte seien ihm "einfach nur so zugeflogen", und er muß selber wissen, daß das für einen Roman an Stilwillen zuwenig ist. "Ein Brief ist eine zwiespältige Botschaft", weiß der Autor selbst genau, weil er vorspielt, die Distanz zwischen Absender und Adressat zu überbrücken, obwohl natürlich alle wissen, daß diese Distanz selbst zwischen Liebenden einen Abgrund aufreißt. Hätten wir nur genauer erfahren, wer welche Briefe warum an wen schreibt, hätte es der Wehmut keinen Abbruch getan, aber eine gewisse Langeweile unterbunden.
Was dieses uneinheitliche Buch dann doch zusammenhält, ist die wiederkehrende Reflexion über die Liebe, die immer auch ein Trauern über die Zeit bedeutet. Tabucchi macht seinen Lesern klar, "daß die Zeit nicht wartet, daß die Zeit aus Tropfen besteht und ein Tropfen zuviel genügt, damit die Flüssigkeit sich auf den Boden ergießt und sich wie ein Fleck ausbreitet und versickert". Und doch hält dieses pathetische und resignierte Weltbild einen Raum für das Glück bereit. Irgendwann einmal haben die Helden dieser verqueren Flaschenpost geahnt, woraus ihr Glück hätte bestehen können: "Denn die Menschen können glücklich sein in ihrem Inzwischen." Dieses Inzwischen ist der Raum der Literatur.
Antonio Tabucchi: "Es wird immer später". Roman in Briefform. Aus dem Italienischen übersetzt von Karin Fleischanderl. Carl Hanser Verlag, München 2002. 288 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Antonio Tabucchi hat sich "wieder einmal etwas Besonderes ausgedacht", jubelt Martin Krumbholz. Diesmal verwöhnt der Professor für portugiesische Literatur, verkündet der Rezensent, den Leser mit Liebesbriefen. Und zwar allesamt von Schreibern, die ihre große Liebe verloren haben - sei es durch den Tod oder durch Trennung. Allen Briefeschreibern gemein sei, berichtet der Rezensent, dass sie "eloquent", "reif" und "gebildet" sind und ihre Verflossenen mit diesen Briefen trotz aller Imagination ins Reale erheben, wobei "Groll, Reue, Sehnsucht und Trauer" neben "Klarsichtigkeit" und einer Desillusionierung "bis in die Haar- und die Eichelspitzen" stünde, schmunzelt Krumbholz. Der Tonfall wechsle, so der Rezensent, in diesen Briefen vom "Gepflegt-Melancholischen" bis hin ins "Burleske" und "Sarkastische". Die Lektüre dieser Zeilen sei zwar nicht immer leicht verdaulich, findet Krumbholz, aber "ungemein belebend und erhellend" und niemals "blutarm". Verschwiegen werde hier jedenfalls nichts, meint Krumbholz.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Ein kleines Meisterwerk heiterer Melancholie." Die Zeit, 5.09.02 "Mit gelassener Fröhlichkeit schreibt der italienische Dichter Antonio Tabucchi über die letzten und schönsten Dinge des Lebens... Ein gastfreundliches Buch, in dem die Liebe über die Zeit triumphiert." Iris Radisch, Die Zeit, 22.08.2002 "Antonio Tabucchi hat sich wieder einmal etwas Besonderes ausgedacht..." Martin Krumbholz, Frankfurter Rundschau, 21.09.02 "Funkelnde kleine Meisterstücke." Steffen Richter, Die Welt, 26.10.02 "Antonio Tabucchi hat einen wundervollen Band Kurzgeschichten vorgelegt. Wie schön, hin und wieder so unterhaltsame, rührende Post zu erhalten. An diesen Briefen, an diesem Buch führt kein Weg vorbei." Tobias Krause, AZ-München, 24.08.2002