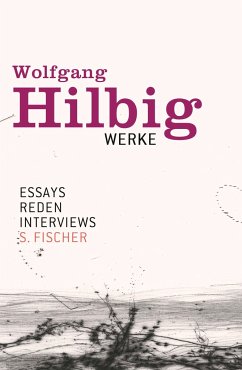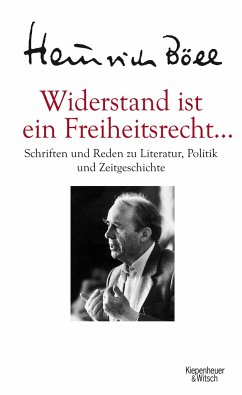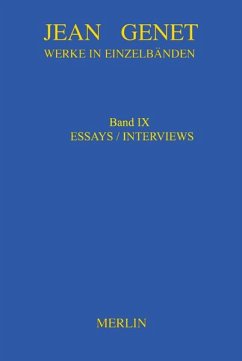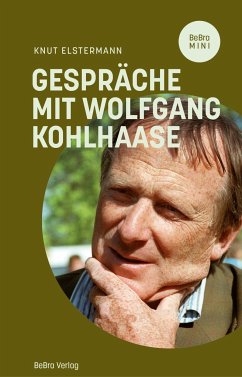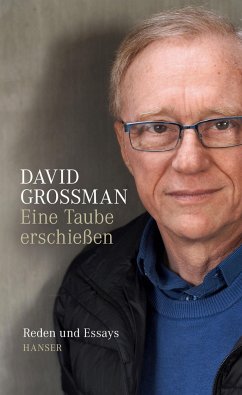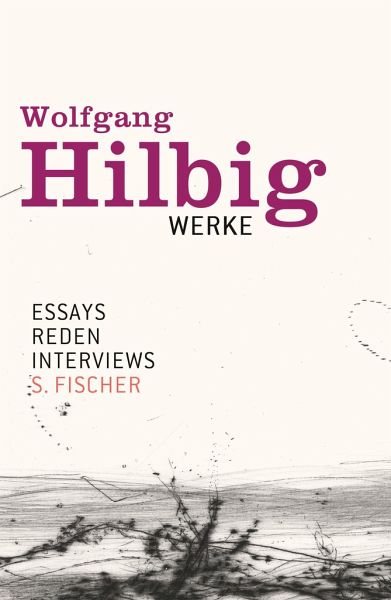
Essays, Reden, Interviews / Wolfgang Hilbig Werke Bd.7

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
In der siebenbändigen Wolfgang-Hilbig-Werkausgabe ist dieser umfangreiche Band mit Essays, Reden und Interviews der unverzichtbare Schlussstein. Zu den mehr als zwanzig Essays gehören Texte über Literatur - auch die Frankfurter Poetikvorlesungen Hilbigs sind hier enthalten -, aber auch über Heimat und die eigene Herkunft. Zu den gesammelten Reden gehören zahlreiche Dankreden für erhaltene Literaturpreise, die weit mehr sind als Danksagungen: Hatte seine »Kamenzer Rede« mit ihrer herben Kritik an der deutschen Wiedervereinigung 1997 noch für einen Skandal gesorgt, wurde die Büchner-Pr...
In der siebenbändigen Wolfgang-Hilbig-Werkausgabe ist dieser umfangreiche Band mit Essays, Reden und Interviews der unverzichtbare Schlussstein. Zu den mehr als zwanzig Essays gehören Texte über Literatur - auch die Frankfurter Poetikvorlesungen Hilbigs sind hier enthalten -, aber auch über Heimat und die eigene Herkunft. Zu den gesammelten Reden gehören zahlreiche Dankreden für erhaltene Literaturpreise, die weit mehr sind als Danksagungen: Hatte seine »Kamenzer Rede« mit ihrer herben Kritik an der deutschen Wiedervereinigung 1997 noch für einen Skandal gesorgt, wurde die Büchner-Preis-Rede von 2002 zu einem melancholischen Rückblick auf die Rolle der Literatur.
36 Interviews und Gespräche mit Wolfgang Hilbig bilden den dritten Teil dieses Bandes. Des öfteren weist er in ihnen darauf hin, dass solche Interviews ihn vom eigentlichen Schreiben abhalten - zugleich bilden sie, wie nun in der Gesamtschau deutlich wird, einen Teil des Werkes. Sie enthalten wichtige Selbstaussagen zur Person und zum literarischen Schaffen, aber auch zahlreiche Stellungnahmen zur DDR, zur Wende von 1989 und dem wiedervereinigten Deutschland - sie sind die beeindruckende Selbstauskunft eines unverwechselbaren Dichters.
36 Interviews und Gespräche mit Wolfgang Hilbig bilden den dritten Teil dieses Bandes. Des öfteren weist er in ihnen darauf hin, dass solche Interviews ihn vom eigentlichen Schreiben abhalten - zugleich bilden sie, wie nun in der Gesamtschau deutlich wird, einen Teil des Werkes. Sie enthalten wichtige Selbstaussagen zur Person und zum literarischen Schaffen, aber auch zahlreiche Stellungnahmen zur DDR, zur Wende von 1989 und dem wiedervereinigten Deutschland - sie sind die beeindruckende Selbstauskunft eines unverwechselbaren Dichters.
Entdecke weitere interessante Produkte
Stöbere durch unsere vielfältigen Angebote