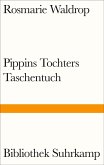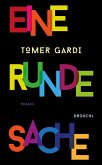Kommt die eigene Sprache erst zu ihrem Wort, wenn sie aus der Selbstverständlichkeit fällt? Ist sie dann in eine Hüpfburg gegangen und prallt mit anderen falschen Freunden zusammen? Oder beugt sie sich mit anderen Frauen über einen Stadtplan und murmelt etymologisch zweifelhafte, aber poetologisch zündende Wegbeschreibungen? Routen für die Leser innen, die von translantischen Texten erst geschrieben werden? In den hier erstmals versammelten Essays und Reden entwirft die Lyrikerin und Übersetzerin Uljana Wolf lustvoll und hellhörig jenes "cargo schmargo" des Gedichts, "die Verschiebung des herrschenden Ausdrucks" als produktive Verstörung angestammter Wahrnehmung von Identität und Sprache. Ob Prosagedicht, Übersetzung, translinguales Schreiben - Wolfs Augenmerk gilt dem schmugglerischen Sprachhandeln, den hybriden Formen, dem "Grundrecht", "jenes und zugleich ein anderes zu sein". Davon bleibt auch die Form des Essays nicht unberührt, wird "Guessay", "Translabor", Versuchsanordnung eines poetischen Denkens, das immer währendes Gespräch ist - unter anderem mit Ilse Aichinger, Peter Huchel, Gertrude Stein, Elisabeth Barrett Browning und Theresa Hak Kyung Cha -, eine Form, die zum Weitersprechen, Fabulieren und gossippen einlädt.
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Rezensent Michael Braun lernt bei Uljana Wolf, dass Wörter fremd werden müssen, um zu sich selbst zu kommen. Wie das geht, erläutert Wolf dem Rezensenten in ihren Essays über die "Wanderbewegungen der Wörter" und die Obsoletheit des Konzepts Muttersprache. Dass die Dichterin und Übersetzerin Wolf dafür prädestiniert ist, bezweifelt der Rezensent nicht. Wolfs Sprachempfinden, ihr Faible fürs "Übermalen" von poetischen Texten wird für Braun sichtbar nicht zuletzt an der Behandlung von Gedichten von Elizabeth Barrett Browning im vorliegenden Band sowie an Wolfs Essays über Ilse Aichinger.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Lyrik kann mehr als bloße Muttersprache: Uljana Wolfs Überlegungen zu einer vielsprachigen Dichtung
Von der Dichterin Uljana Wolf heißt es, sie lebe in ihrer Geburtsstadt Berlin. Liest man allerdings ihre Gedichte, Übersetzungen, Essays und Reden, so entsteht der Eindruck, sie habe sich längst woanders eingerichtet: an einem translingualen Ort, an dem sich das Deutsche und Amerikanische, aber auch das Polnische und Belarussische ineinander verschränken. Wolf hat diesen Ort über die vergangenen fünfzehn Jahre nicht nur poetisch zum Erblühen gebracht. Offenbar hat sie es auch verstanden, ihn theoretisch zu vermessen. An ihrem neusten Band unter dem Titel "Etymologischer Gossip" lässt sich ablesen, wie die Dichterin sich Schritt für Schritt eine eigenständige Theorie translingualer Poesie erarbeitet hat.
Der Band führt 24 Beiträge zusammen, die bislang weit verstreut vorlagen. Die beiden frühesten Texte stammen aus dem Jahr 2006, die jüngsten von 2018. Die Essays zeigen, dass die Frage nach der Bewohnbarkeit einen wichtigen Ausgangspunkt für Wolfs Poetik bildet. Die Berlinerin betonte schon in ihrer ersten großen Rede, bei der Verleihung des Peter-Huchel-Preises: "Aus dem Wortschatz wird ein Wohnschatz, das Gedicht ist bewohnbar, die Grundworte ruhen in sich und sprechen uns an. Und das Gedicht ist nach allen Seiten offen, ist zugig, unbewohnbar, wenn es über sich hinausweist, mit unerwartetem Bild, mit klarer Fügung einem den Stoß versetzt, der aus dem Vertrauten ins unvertraut Neue führt." Diese Überlegungen setzt sie konstant fort, bis hin zu ihren Überlegungen zu Wiegenliedern (2017), bei denen ja auch die erste Konfrontation des Eigenen über das Fremde erfolgt.
Die zweite Konstante bildet die intensive Auseinandersetzung mit den Arbeiten von Ilse Aichinger. Bereits im ersten Essay, aus dem Jahr 2006, lässt sich pointiert beobachten, wie die wolftypischen Sätze, sich aus der Reibung mit Aichingers "Queens" und somit aus einer spezifischen Form des Fortschreitens und Abwartens formieren, um dann ihrerseits das Aufgenommene neu zu wenden: "Das meint warten, withdraw, ich nehme mich zurück, aber etwas nehme ich mit, with."
Wolf präsentiert sich in ihren Essays, als eine vom Willen zum Wissen getriebene Spurenleserin, deren spielerische, gewagte, spekulative Denkart eigene Denkwege sucht: "Und weiter?", fragt sie an einer Stelle, um sich in "Vermutungen, Passagen" fortzubewegen. Als versierte Guesseyistin könnte man sie wohl nach einer ihrer eigenen Wortschöpfungen bezeichnen. Denn im "Guessay", dem Rateversuch, eröffnet sich die Poetin auch noch jenen Spielraum von Ahnung und Vermutung, der ihr im Essay verschlossen bleiben würde. Was uns das sagt? "Es ist wohl nichts gesagt", so Wolf, als dass ich "mich verhake, meine Fäden sticke, mich sinnstiftend verstrickte. Anstatt mich ausfädeln zu lassen, will ich zusammenlesen, was vielleicht nicht zusammenzulesen ist." Besticken, Verstricken - das bleibt der Gestus von Wolfs assoziationspräzisen Lektüren.
Die translinguale Lyrik hat in den vergangenen Jahren mit Autorinnen wie Yoko Tawada, Cia Rinne, Dagmara Kraus, Alexandru Bulucz, aber auch mit einzelnen Büchern wie Ulf Stolterfohts "Was Branko sagt", eine hochproduktive Phase durchlaufen. Ihren Ausgangspunkt - so sieht man in Wolfs Essays schnell - bildet eine Auseinandersetzung mit der poetischen Übersetzung. Wolf zählt zu jenen Übersetzerinnen, die sich vom Ufer der deutschen Sprache abstoßen, um zum Ufer der anderen Sprache überzusetzen. Allerdings hat Wolf eine Vorliebe dafür, sich in den Sprachflüssen und -wirbeln treiben oder schaukeln zu lassen. Translinguale Poesie beruht gerade nicht darauf, sich möglichst direkt von einer zur anderen Sprache zu bewegen. Oder wie es Uljana Wolf im titelgebenden Beitrag "Etymologischer Gossip" über ihre Denkbewegung festhält: "Mein Nachgehen braucht Umwege." Erst der Umweg führt schnurstracks zu jenem Ziel, von dem man zuvor nichts ahnte. Am liebsten verstrickt Wolf sich daher mit größter Genauigkeit darin, die Verwurzelungen zwischen den Sprachen bis in die feinsten Filiationen zu erforschen. Translinguale Poesie arbeitet demnach streng rhizomatisch.
Wolf reflektiert, dass ein translinguales Gedicht phänotypisch nicht unbedingt als mehrsprachig erscheinen muss. Weil es subkutan mit mehreren Sprachen verflochten sein kann: "Ein einsprachiges Gedicht kann in seinem Denken / mehrsprachig sein." Das poetische wie essayistische Erforschen dieser Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Sprachen führt im besten Fall dazu, die eigene Sprache zu destabilisieren. Sie sei eine Möglichkeit, "die Sprache sich selbst zu entfremden und so allein zu lassen, dass sie wieder allein sprechen muss", hielt bereits Aichinger fest. Die Sprache wird abermals unvertraut, weil sie eine per se multilinguale Erscheinung ist. Language is migrant - "Sprache ist migrantisch. Wörter bewegen sich von Sprache zu Sprache, von Kultur zu Kultur, von Mund zu Mund" -, so zitiert Wolf die chilenische Dichterin Cecilia Vicuña. Wie der Tratsch, Klatsch, Halbwahrheit, wie zirkulierender gossip, so wandert auch das Fremde durch unsere Sprachkörper. "Ich habe nur eine Sprache, und sie ist nicht meine", behauptete Jacques Derrida treffend.
Translinguale Poesie, so zeigt Wolf in ihren Studien auf höchst anregende Weise, unterläuft somit auch die Vorstellung, man könne nur in einer, nämlich in seiner Muttersprache dichten. Sie ersetzt diese Idee durch eine durchlässige Viel- und Mehrsprachigkeit. Und weil die Sprache Identitäten und nationale Denkweisen schafft, gerät mit der Multilingualität auch das System politischer Zuschreibungen und Einschreibungen in Bewegung. Das Gedicht wird auf neue Weise bewohnbar und unbewohnbar zugleich.
Am eindrücklichsten kann Uljana Wolf diese Bedingungen und Möglichkeiten ihres Dichtens entfalten, wann immer sie selbst zur Leserin wird: Wenn sie anhand von Dagmara Kraus' Band "liedvoll, deutschyzno" eine "deutsch-polnische Portmanteugrafie" entfaltet. Wenn ihr auf Abwegen in der Bibliothek der römischen Villa Massimo der "Pentamerone" von Giambattista Basiles in die Hände fällt und sie den Spuren der Petersilie zu folgen beginnt. Oder wenn sie in einem der eindrücklichsten Beiträge des Bandes Theresa Hak Kyungs "Dictee" für sich und ihre Leser entdeckt. Dann wird Uljana Wolf zur Kuratorin von Worten, Versprechern und mitunter sogar - wer meidet schon jedes Risiko? - von "Falschen Freunden", zu einer Guesseyistin, der man fasziniert in die Welt translingualer Verstrickungen folgt. CHRISTIAN METZ
Uljana Wolf: "Etymologischer Gossip". Essays und Reden.
Kookbooks Verlag, Berlin 2021. 234 S., geb., 22,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main