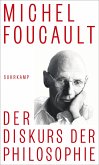Dieses Buch ist ein Experiment. Es unternimmt den Versuch, eine Geistesgeschichte der geistigen Beeinträchtigung zu schreiben, indem es die Debatten über den Wert behinderten Lebens nachzeichnet, wie sie in den letzten 150 Jahren geführt wurden. Abgrund dieser Epoche war ein schier unvorstellbares Massenmordprojekt, das eine komplexe Vorgeschichte hat und eine erstaunlich lange Nachgeschichte. Die Eugenik zu verlernen, hat sich in Deutschland als ein außerordentlich zäher Prozess erwiesen, der bis heute nicht abgeschlossen ist.
Dagmar Herzog schildert die immer wiederkehrenden Konflikte über die Deutung von Fakten und die daraus zu ziehenden praktischen Konsequenzen. In diesen sowohl politisch als auch emotional hoch aufgeladenen Auseinandersetzungen vermischten sich Konzepte aus Medizin und Pädagogik mit religiös-theologischen Vorstellungen, aber auch mit solchen über Arbeit und Sexualität, menschliche Verwundbarkeit und wechselseitige Abhängigkeit. Wie soll man über die Mitbürger:innen mit den unterschiedlichsten kognitiven Beeinträchtigungen und psychiatrischen Diagnosen denken und fühlen? Wie mit ihnen umgehen? Indem die Deutschen über diese Fragen stritten, rangen sie stets auch um ihr Selbstverständnis als Nation.
Dagmar Herzog schildert die immer wiederkehrenden Konflikte über die Deutung von Fakten und die daraus zu ziehenden praktischen Konsequenzen. In diesen sowohl politisch als auch emotional hoch aufgeladenen Auseinandersetzungen vermischten sich Konzepte aus Medizin und Pädagogik mit religiös-theologischen Vorstellungen, aber auch mit solchen über Arbeit und Sexualität, menschliche Verwundbarkeit und wechselseitige Abhängigkeit. Wie soll man über die Mitbürger:innen mit den unterschiedlichsten kognitiven Beeinträchtigungen und psychiatrischen Diagnosen denken und fühlen? Wie mit ihnen umgehen? Indem die Deutschen über diese Fragen stritten, rangen sie stets auch um ihr Selbstverständnis als Nation.
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Ein wichtiges Buch, das schwer zu ertragen ist, hat Dagmar Herzog laut Rezensentin Regina Schidel geschrieben. Es widmet sich, erfahren wir, der Geschichte der deutschen Eugenik, wobei die systematischen Morde der Nationalsozialisten zwar im Zentrum der Argumentation stehen, jedoch nicht das alleinige Thema sind. Stattdessen zeichnet Herzog Schidel zufolge nach, wie bereits Ende des 19. Jahrhunderts menschliches Leben unter dem Aspekt der Nützlichkeit betrachtet wurde, weshalb Forderungen, unter anderem von Karl Binding und Alfred Hoche vorgebracht, nach Tötung vermeintlich unwerten Lebens in der Bevölkerung auf breiten Rückhalt stießen. Was die Behindertenmorde der Nazis angeht, wird im Buch, legt die Rezensentin dar, unter anderem die wenig erfreuliche Rolle der Kirchen thematisiert. Auch die äußerst schleppende Aufarbeitung der Euthanasie-Verbrechen findet im Buch Erwähnung, heißt es weiter, wobei Schidel der Ansicht ist, dass Herzog noch zu gnädig mit unserer Gegenwart ist. Der Autorin zufolge hat die Gesellschaft einiges gelernt im Umgang mit Behinderung. Die ansonsten von dem Buch sehr angetane Rezensentin hingegen verweist auf nach wie vor grassierende Behindertenfeindlichkeit, unter anderem mit Blick auf selektive Schwangerschaftsabbrüche.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Den Euthanasiemorden der Nationalsozialisten fielen zwischen 1939 und 1945 an die 300.000 Menschen zum Opfer. Mehrheitlich handelte es sich um psychisch Kranke, geistig oder körperlich behinderte Insassen von Heil-und Pflegeanstalten, deren Leben als "lebensunwert" galt. Die unselige Karriere dieses Begriffs begann im Jahr 1920 mit der Veröffentlichung der Schrift "Die Freigabe zur Vernichtung lebensunwerten Lebens", verfasst von dem angesehenen Juristen Karl Binding und dem nicht minder namhaften Psychiater Alfred Hoche. Zwar gab es seit dem ausgehenden neunzehnten Jahrhundert immer wieder Versuche, Mordgedanken gegen behinderte Personen salonfähig zu machen und das christliche Fürsorgeleitbild zu durchbrechen. Doch erst der schmale Band des renommierten Autorenduos führte zu einer folgenschweren diskursiven Umorientierung und verankerte den Begriff des "lebensunwerten Lebens" im allgemeinen Sprachgebrauch und kollektiven Denken.
Dieser moralisch-politischen Destabilisierung widmet Dagmar Herzog eines der fünf Kapitel ihrer vielschichtigen Studie zur wechselvollen Geschichte der deutschen Debatte über den Wert des behinderten Lebens. Zudem rekonstruiert die in New York lehrende Historikerin die Vorgeschichte der titelgebenden "eugenischen Phantasmen", die im nationalsozialistischen Massenmord kulminierten, und zeigt, wie zählebig diese Ideologie in der Bundesrepublik nachwirkte. Rund 150 Jahre geraten hierbei in den Blick: angefangen bei der Herausbildung einer soliden Infrastruktur an karitativen Einrichtungen von 1870 an, die mit einer Klassifizierung und Hierarchisierung der unterschiedlichen Beeinträchtigungen (nach "Heilbarkeit" und "Brauchbarkeit") einherging, über die allmähliche Einbettung des Themas Behinderung in den "rassenhygienischen" Kontext bis hin zu den Selbstbestimmungs- und Inklusionspostulaten der Gegenwart. Dabei stellt Herzog immer wieder aufs Neue die Frage, welche zeithistorischen und mentalitätsgeschichtlichen Gegebenheiten, Gruppendynamiken, Interessenlagen und Argumente zusammenkommen müssen, damit sich die Paradigmen einer gesamtgesellschaftlichen Debatte in die ein oder andere Richtung verkehren konnten.
Im Fall der diskursiven Neujustierung, die von Binding und Hoche in der Weimarer Republik angestoßen wurde, spielte neben der desolaten wirtschaftlichen Lage auch der gekränkte Nationalstolz nach dem Ersten Weltkrieg eine Rolle. Daher wurde die Öffentlichkeit besonders hellhörig, als die Pflege- und Heilanstalten von den beiden Autoren als enormer Kostenfaktor gegeißelt wurden. Auf Zustimmung stießen auch die sozialdarwinistischen Passagen, in denen Binding und Hoche es als "kontraselektiv" verdammten, dass die "unheilbar Blödsinnigen" über Jahrzehnte hinweg "künstlich großgepeppelt" wurden. Der Vorwurf richtete sich ausdrücklich ans christliche Lager, die Hauptinstanz der Behindertenfürsorge. Akribisch durchforstet Herzog die bisher kaum erforschten Schriften, in denen Pfarrer, Theologen und Heilpädagogen auf Binding und Hoche reagierten. In einigen dieser Stellungnahmen findet sich aufrechtes Entsetzen und scharfer Widerspruch. Aus anderen spricht Ambivalenz oder als Barmherzigkeit getarnte Befürwortung der Mordidee. So war der Hamburger Geistliche und Anstaltsdirektor Friedrich Lensch keineswegs der Einzige, der in rhetorischer Absicht die Frage aufwarf, "ob man nicht schon um der Kranken selbst willen sie von diesem Leben, dass doch kaum Leben genannt werden könne, befreien sollte".
Folgt man Herzog, grassierte bereits vor 1933 eine regelrechte "Theo-Biopolitik" unter tonangebenden Christen, von denen sich die meisten bemühten, dem eugenischen Diskurstrend zumindest auf halber Strecke entgegenzukommen. Symptomatisch für diese Kompromissbereitschaft war die "Treysaer Resolution". Ein programmatisches Dokument, das 1931 von führenden Vertretern des karitativen protestantischen Dachverbands "Innere Mission" verabschiedet wurde und als Alternative zum Massenmord an behinderten Menschen deren Sterilisation vorschlug, zunächst noch auf "freiwilliger" Basis. Als 1934 das nationalsozialistische Gesetz zur Zwangssterilisation in Kraft trat, gelangte dies in protestantischen Heimen mit konfessionstypischem Pflichteifer zur massenhaften Anwendung. Die katholische Seite äußerte offiziell Missbilligung, ließ die Eingriffe aber in ihren Einrichtungen dennoch zu. Ungefähr 400.000 als "erbkrank" eingestufte Menschen wurden bis 1945 zwangsweise unfruchtbar gemacht.
Die eugenischen Verbrechen des Dritten Reichs werden von Herzog nur knapp behandelt. Umso ausführlicher widmet sie sich der Frage, unter welchen Bedingungen ein Verbrechen überhaupt als solches erkannt und anerkannt wird. Denn damit hatte man es nach 1945 hierzulande ganz und gar nicht eilig, zumindest was die Leidtragenden des nationalsozialistischen Eugenikprogramms betraf. Gemäß dem westdeutschen Entschädigungsgesetz von 1956 wurden nämlich nur jene, die "aus Gründen der Rasse, des Glaubens oder der Weltanschauung" verfolgt wurden, als Opfer des Dritten Reichs anerkannt. Und die eugenischen Massenmorde und Verstümmelungen wurden, so die heute unvorstellbare, damals aber offizielle Interpretation, aus keinem dieser Gründe begangen.
Dabei hatten die Nationalsozialisten und ihre Vordenker einst selbst unmissverständlich formuliert, dass die "Ballastexistenzen" beseitigt werden müssten, um aus den Deutschen endlich ein schönes, vitales, kluges, überlegenes Volk zu machen. Wenn Herzog diese affektive Verheißung des Dritten Reichs prägnant herausarbeitet, knüpft sie ausdrücklich an ihr originelles Buch zur nationalsozialistischen Sexualpolitik ("Die Politisierung der Lust", 2005) an. Die Erkenntnis, dass die NS-Eugenik integraler Bestandteil des NS-Rassismus war, dämmerte dem bundesrepublikanischen Bewusstsein erst nach 1980, als endlich auch die diskriminierende Erinnerungs- und Entschädigungspolitik korrigiert wurde.
In den letzten beiden Kapiteln, die sich dem Verlernen der Eugenik in Ost- und Westdeutschland kurz vor und nach der Wiedervereinigung widmen, würdigt Herzog die "radikalen Verfechter der Ententmenschlichung", die mit unterschiedlichsten Mitteln gegen die Abwertung des behinderten Daseins gekämpft haben: die Historikerin Gisela Bock, der Journalist Ernst Klee, der Psychiater Klaus Dörner, die Mitglieder der "Krüppelbewegung" und der Schriftsteller Franz Fühmann, der in der dezidiert antifaschistischen, antieugenischen DDR gegen die realexistierende Behindertenfeindlichkeit anschrieb.
Wenn Herzog im Nachwort nochmals die Errungenschaften dieser Aktivisten und Wissenschaftler für die aufmerksam gewordene Gegenwart rühmt, rundet sich ihre nüchtern-prägnante Diskursgeschichte zu einer moralischen Fortschrittserzählung, die nicht völlig frei von Pathos ist. Wem das zu optimistisch anmutet, der muss sich lediglich an die vorangegangenen Seiten erinnern, auf denen Herzog rekonstruiert hat, wie umstandslos Zivilisation in Barbarei kippt. MARIANNA LIEDER
Dagmar Herzog: "Eugenische Phantasmen". Eine deutsche Geschichte.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2024.
390 S., Abb., geb., 36,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.
»[Eine] brillante Studie ... Zum Verlernen eugenischer Phantasmen und einem Bekenntnis zu radikaler Gleichwertigkeit menschlicher Differenz bietet Dagmar Herzogs Buch und dessen Lektüre ... einen entscheidenden Schlüssel.« Regina Schidel wochentaz 20240920