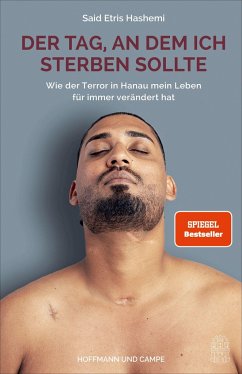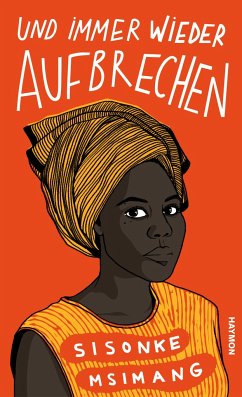Nicht lieferbar

Eure Heimat ist unser Albtraum
Mit Beiträgen von Sasha Marianna Salzmann, Sharon Dodua Otoo, Max Czollek, Mithu Sanyal, Olga Grjasnowa, Margarete Stokowski uvm.
Herausgegeben: Aydemir, Fatma; Yaghoobifarah, Hengameh
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
Wie fühlt es sich an, tagtäglich als "Bedrohung" wahrgenommen zu werden? Wie viel Vertrauen besteht nach dem NSU-Skandal noch in die Sicherheitsbehörden? Was bedeutet es, sich bei jeder Krise im Namen des gesamten Heimatlandes oder der Religionszugehörigkeit der Eltern rechtfertigen zu müssen? Und wie wirkt sich Rassismus auf die Sexualität aus?Dieses Buch ist ein Manifest gegen Heimat - einem völkisch verklärten Konzept, gegen dessen Normalisierung sich 14 deutschsprachige Autor_innen wehren. Zum einjährigen Bestehen des sogenannten "Heimatministeriums" sammeln Fatma Aydemir und Heng...
Wie fühlt es sich an, tagtäglich als "Bedrohung" wahrgenommen zu werden? Wie viel Vertrauen besteht nach dem NSU-Skandal noch in die Sicherheitsbehörden? Was bedeutet es, sich bei jeder Krise im Namen des gesamten Heimatlandes oder der Religionszugehörigkeit der Eltern rechtfertigen zu müssen? Und wie wirkt sich Rassismus auf die Sexualität aus?
Dieses Buch ist ein Manifest gegen Heimat - einem völkisch verklärten Konzept, gegen dessen Normalisierung sich 14 deutschsprachige Autor_innen wehren. Zum einjährigen Bestehen des sogenannten "Heimatministeriums" sammeln Fatma Aydemir und Hengameh Yaghoobifarah schonungslose Perspektiven auf eine rassistische und antisemitische Gesellschaft. In persönlichen Essays geben sie Einblick in ihren Alltag und halten Deutschland den Spiegel vor: einem Land, das sich als vorbildliche Demokratie begreift und gleichzeitig einen Teil seiner Mitglieder als »anders« markiert, kaum schützt oder wertschätzt.
Mit Beiträgen von Sasha Marianna Salzmann, Sharon Dodua Otoo, Max Czollek, Mithu Sanyal, Margarete Stokowski, Olga Grjasnowa, Reyhan Sahin, Deniz Utlu, Simone Dede Ayivi, Enrico Ippolito, Nadia Shehadeh, Vina Yun, Hengameh Yaghoobifarah und Fatma Aydemir.
Dieses Buch ist ein Manifest gegen Heimat - einem völkisch verklärten Konzept, gegen dessen Normalisierung sich 14 deutschsprachige Autor_innen wehren. Zum einjährigen Bestehen des sogenannten "Heimatministeriums" sammeln Fatma Aydemir und Hengameh Yaghoobifarah schonungslose Perspektiven auf eine rassistische und antisemitische Gesellschaft. In persönlichen Essays geben sie Einblick in ihren Alltag und halten Deutschland den Spiegel vor: einem Land, das sich als vorbildliche Demokratie begreift und gleichzeitig einen Teil seiner Mitglieder als »anders« markiert, kaum schützt oder wertschätzt.
Mit Beiträgen von Sasha Marianna Salzmann, Sharon Dodua Otoo, Max Czollek, Mithu Sanyal, Margarete Stokowski, Olga Grjasnowa, Reyhan Sahin, Deniz Utlu, Simone Dede Ayivi, Enrico Ippolito, Nadia Shehadeh, Vina Yun, Hengameh Yaghoobifarah und Fatma Aydemir.