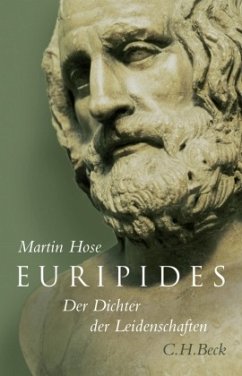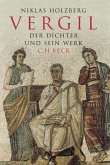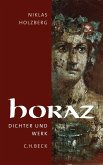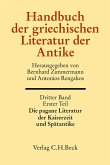Der Dichter der Leidenschaften
Martin Hose, Klassischer Philologe und international renommierter Literaturwissenschaftler, legt eine moderne Darstellung von Leben und Werk des Euripides vor. Die Tragödien dieses bedeutenden griechischen Dichters bewegen in ihrer ungebrochenen Aktualität auch heute noch gleichermaßen Leser und Theaterbesucher. Das Geheimnis ihrer Wirkungsmacht - das Mitgefühl des Euripides für Leid und Verzweiflung von Tätern und Opfern - wird in diesem Band erhellt.
Keiner der großen Tragödiendichter der Antike mutet moderner an als der Athener Euripides (5. Jahrhundert v. Chr.). Viele seiner Stücke - darunter Elektra, Hekabe, Iphigenie im Taurerland, Medea und Die Bakchen - sind feste Bestandteile unseres kulturellen Gedächtnisses geworden und erscheinen regelmäßig auf den Theaterspielplänen. Sie konfrontieren uns in ihrer ungebrochenen Aktualität stets aufs neue mit ethischen Grundfragen des menschlichen Lebens. Martin Hose - ein international anerkannter Euripides-Spezialist - stellt hier den antiken Dichter, sein Leben, seine erhaltenen Tragödien sowie - mit dem Kyklops - sein einziges erhaltenes Satyrspiel vor. Er analysiert die Stellung der Dramen des Euripides im politischen und intellektuellen Kontext des klassischen Athen, zeigt ihren Charakter als literarische Versuchsanordnungen, ordnet sie literaturgeschichtlich ein und bestimmt ihr Verhältnis zu jenen der beiden anderen bedeutenden Tragödiendichter Athens - Aischylos und Sophokles. Die Darstellung ist ebenso informativ wie anregend und richtet sich an alle Freunde der griechischen Tragödie.
Martin Hose, Klassischer Philologe und international renommierter Literaturwissenschaftler, legt eine moderne Darstellung von Leben und Werk des Euripides vor. Die Tragödien dieses bedeutenden griechischen Dichters bewegen in ihrer ungebrochenen Aktualität auch heute noch gleichermaßen Leser und Theaterbesucher. Das Geheimnis ihrer Wirkungsmacht - das Mitgefühl des Euripides für Leid und Verzweiflung von Tätern und Opfern - wird in diesem Band erhellt.
Keiner der großen Tragödiendichter der Antike mutet moderner an als der Athener Euripides (5. Jahrhundert v. Chr.). Viele seiner Stücke - darunter Elektra, Hekabe, Iphigenie im Taurerland, Medea und Die Bakchen - sind feste Bestandteile unseres kulturellen Gedächtnisses geworden und erscheinen regelmäßig auf den Theaterspielplänen. Sie konfrontieren uns in ihrer ungebrochenen Aktualität stets aufs neue mit ethischen Grundfragen des menschlichen Lebens. Martin Hose - ein international anerkannter Euripides-Spezialist - stellt hier den antiken Dichter, sein Leben, seine erhaltenen Tragödien sowie - mit dem Kyklops - sein einziges erhaltenes Satyrspiel vor. Er analysiert die Stellung der Dramen des Euripides im politischen und intellektuellen Kontext des klassischen Athen, zeigt ihren Charakter als literarische Versuchsanordnungen, ordnet sie literaturgeschichtlich ein und bestimmt ihr Verhältnis zu jenen der beiden anderen bedeutenden Tragödiendichter Athens - Aischylos und Sophokles. Die Darstellung ist ebenso informativ wie anregend und richtet sich an alle Freunde der griechischen Tragödie.

Euripides ist, im Gegensatz zu seinen Konkurrenten, nicht hölderlinförmig genug. Dabei wird es Zeit, ihn wieder zu lesen. Er belehrt nicht, er beweist nicht, er erweitert unsere Sensibilität, er gibt Zweifelsfragen auf. Martin Hose klärt sie.
Von Kurt Flasch
Das Siegesfest der Griechen stand an. Troja, wo immer es gelegen haben mag, war nach zehn Jahren Krieg gefallen. Seine Männer waren getötet, seine Frauen und Kinder zur Sklaverei in Griechenland verurteilt; sie wurden auf die Sieger verteilt und warteten auf den Abtransport. Die griechischen Schiffe standen zur Abfahrt bereit. Sie sollten Helena als Gefangene zurückbringen. Ihr königlicher Gatte wollte sie in Sparta hinrichten; schließlich hatte die Treulose den Krieg verursacht. Von einem griechischen Dichter, der über diesen Triumphtag ein Theaterstück für sein Publikum in Athen schrieb, konnte man erwarten, dass er den gewonnenen Krieg und die Heimkehr der Flotte bejubelte. Sein Thema war vorgegeben: Dankopfer für die hilfreichen Götter und Einzug der siegreichen Krieger.
Euripides (circa 485 bis 407/406 vor Christus) erfüllte all diese Erwartungen nicht. Seine Tragödie "Die Troerinnen" handelt von der Schlussszene des gewonnenen Krieges, zeigt dieses Siegesfest aber als Katastrophe - kein Preis der Götter, kein Lob der Feldherren, keine triumphale Rückkehr in die Heimat. Nicht die siegreichen Männer stehen im Mittelpunkt, sondern die unglücklichen Frauen. Und ein Kind, das die Sieger von einem Turm werfen; sie mussten es zerschmettern, denn es war der Sohn des Herrschers, und mit ihm hätte die Dynastie weiter bestehen können. Und was war mit den Göttern? Hatten sie geholfen? Ihre Haltung war zweideutig: Poseidon stand auf der Seite des besiegten Troja, aber Athene, die Schutzgöttin Athens, war beleidigt, weil ihr Heiligtum in der besiegten Stadt entweiht worden war. In ihrem Zorn bittet sie Poseidon, er solle die rückkehrende griechische Flotte vernichten. Die Sieger kamen, wie man weiß, nie an. "Die Troerinnen" des Euripides zeigen diesen Krieg nicht nur als Untergang Trojas, sondern auch als Katastrophe für Athen. Wer das Stück gesehen hatte, ging mit dem Zweifel nach Hause: Wurde die Freiheit Athens am Skamander verteidigt?
Es wird Zeit, wieder Euripides zu lesen. Er belehrt nicht, er beweist nicht, er erweitert unsere Sensibilität, er gibt Zweifelsfragen auf. Kurt Steinmann hat vor ein paar Jahren die Bacchantinnen neu übersetzt, ebenso Raoul Schrott, als er noch nicht seine poetische Kraft darauf verlegt hatte, Troja zu verlegen. Man fragt wieder nach Euripides. Das Theater von Luzern spielt zur Zeit die "Medea". In dieser Tragödie rächt sich eine verlassene Ehefrau. Deren Mann hat sie verlassen und erklärt dies seiner wütenden Frau: Er kann als Einwanderer seine prekäre soziale Stellung sichern, auch für seine Kinder, indem er die Königstochter von Sparta heiratet. Medea, die kräuterkundige weise Frau, rächt sich, indem sie ihre Rivalin und deren Vater mit Zaubermitteln umbringt. Sie zerstört das Leben ihres treulosen Gatten und ihr eigenes, indem sie die gemeinsamen Kinder tötet. Diese Tragödie quillt über von aktuellen Fragen: Die Angst des Fremden vor dem Abstieg, die Überlegenheit der intelligenteren Frau, einer unerwünschten Ausländerin. Sie versteht sich als Repräsentantin ihres Geschlechts und der Immigranten. Diese selbstbewusste Gattin, Enkelin des Helios, nimmt das Verlassenwerden nicht demütig hin. Euripides gestaltet den Zwiespalt der Mutter, die ihre eigenen Kinder umbringt; er formuliert den Zweifel an den Göttern während der griechischen Aufklärung.
Martin Hose, Gräzist an der Münchner Universität, gibt in seinem neuen Buch gedrängte Auskunft über den dritten der drei großen griechischen Tragödiendichter, der in der deutschen Kultur ein wenig zurücktritt gegenüber Sophokles und Aischylos. Er ist nicht hölderlinförmig genug. Hose setzt ein mit der launigen Bemerkung des Komödiendichters Aristophanes, nachdem Euripides gestorben sei, habe der Theatergott Dionysos sich gelangweilt. Er erzählt das Wenige, das wir vom Leben des Euripides wissen: Seine Mutter sei Gemüsehändlerin gewesen, und seine Frau habe ihn betrogen. Er galt als mürrisch und gedankenversunken; er ist noch kurz vor seinem Tod aus Athen ausgewandert; in Makedonien sollen ihn wilde Hunde zerrissen haben. Das klingt schnurriger, als es bei Martin Hose steht, der als seriöser Philologe uns einführt in die atheniensische Krisensituation des fünften, vorchristlichen Jahrhunderts. Durchgehend zeigt er die politischen Aspekte der Dramen; deren ausschließlich politische Interpretation wehrt er ab. Er informiert detailliert über den Aufbau griechischer Tragödien und schafft damit die Voraussetzung, um anschließend die einzelnen Dramen in ihrer Struktur zu analysieren. Er hält bei der Interpretation jedes Theaterstücks immer vier Bälle in der Luft: Die formale Struktur der Tragödie, die damalige politische und soziale Krise, die intellektuelle Situation im Umkreis des Sokrates und der Sophisten, schließlich die Auseinandersetzung des Euripides mit den großen Konkurrenten: Aischylos und Sophokles.
Dieses Ballspiel auf beengtem Raum verdient Bewunderung. Er hält diese vier Gesichtspunkte kohärent durch, und wo es nötig ist, klärt er Einzelheiten der Textüberlieferung. Darüber hinaus achtet er auf Umschichtungen, Neuerungen und Entwicklungen im Gesamtwerk des Euripides, der insgesamt zweiundneunzig Dramen verfasst haben soll, von denen achtzehn erhalten sind. Als Gesamtbild zeichnet sich ab: Euripides als Zweifler und Fragender. Er tritt mehr und mehr heraus aus dem Rahmen des Mythos und geht über zur psychologischen Analyse. Er interessiert sich weniger für Götter als für den Zwiespalt von Menschen in geschichtlicher Krisenzeit. Er kennt die Zerrissenheit von Frauen und Männern; er lässt Könige auftreten, die mehrmals ihren Standpunkt wechseln. Er zeigt Götter, deren Schutzwirkung sich aufhebt, weil sie gleichzeitig auf beiden kämpfenden Seiten stehen. Er sieht besorgt auf die expansive Militärpolitik Athens. Er plädiert für Frieden, er spricht mit den Troerinnen gegen militärische Expeditionen in fremde Länder, wie die im selben Jahr stattfindende Militäraktion gegen Syrakus, die mit einer blutigen Niederlage endete. Euripides ist kein Pazifist; aber wenn Kriege geführt werden, dann nur, wenn es wirklich sein muss und nur zur Verteidigung des eigenen Bodens.
Martin Hose bespricht kundig und konzentriert alle achtzehn erhaltenen Dramen. Das gibt seinem Buch fast den Charakter eines Kompendiums. Es ist sorgfältig gearbeitet, nimmt ständig Rücksicht auf die Forschungslage; es liefert Bibliographie und Register. Der Verfasser erklärt, er wünsche sich eine Leserschaft, "die nicht aus Philologen besteht". Das war auf 250 Seiten nicht zu schaffen. Dazu hätte er auswählen müssen. Wer eine der Tragödien schon kennt, liest den betreffenden Abschnitt mit großem Gewinn. Ohne diese Vorbereitung wirken die einzelnen Kapitel wie ausgearbeitete Artikel aus der Realenzyklopädie für klassisches Altertum. Wehmütige Erinnerungen an die großen Stilisten unter den Gräzisten tauchen auf: Wilamowitz-Moellendorff und Werner Jaeger, Karl Reinhardt und Wolfgang Schadewaldt waren gelehrt, sehr gelehrt, aber sie konnten einladend schreiben.
Der gelehrte Münchner Ordinarius beendet sein Vorwort, indem er leise bedauernd mitteilt, er habe sich nicht getraut, in diesem Buch "ich" zu sagen. Er fragt mit vornehmer Bangigkeit den Leser, ob sein Buch vielleicht trotzdem "subjektiver" ausgefallen sei, als es dieser Verzicht erscheinen lasse. Aber bekanntlich sind alle Bücher "subjektiv"; auch ein Lexikonartikel ist es. Der Verfasser hatte keinen Grund, sich zu verstecken und seine Selbstverhüllung zu bedauern. Dieser Euripides zeigt das persönliche Profil des Autors, und das danken wir ihm. Er hat uns einen großen Autor neu erschlossen. Jetzt wissen wir wieder, was wir an Euripides haben. Wir verstehen auch die altgriechische Legende, die von Euripides erzählt: Die Götter hätten in ihrem Zorn auf den Gottlosen dreimal den Blitz in sein Grab einschlagen lassen.
- Martin Hose, Euripides. Der Dichter der Leidenschaften. C.H. Beck Verlag München 2008, 256 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Zwar hätte sich Rezensent Albert von Schirnding bei der Darstellung dieses großen antiken Autors gerade auf Grund des Untertitels der Publikation etwas mehr Leidenschaft und auch farbigere Etikettierungen gewünscht. Auch kritisiert er die "Einebnung der Extreme", die seit Aristophanes die Auseinandersetzungen mit diesem Dichter charakterisierten. Dennoch findet er diese Monografie verdienstreich, die dem Rezensenten zufolge Inhalte, Mythen, Zeit- und Rezeptionskontexte sorgfältig aufarbeite, auch wenn er sich dabei mitunter eine stärkere Konzentration auf die Sprachkunst des Eurides hätte vorstellen können.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH