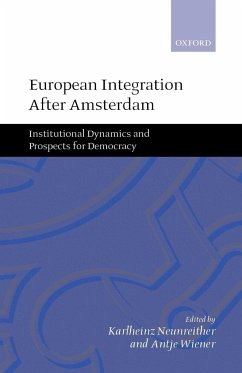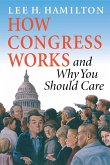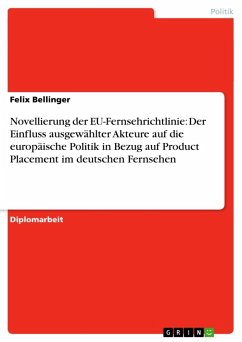European integration is at a turning point with implications for all member states and their citizens. The Amsterdam treaty marks a shift towards constitutional issues. Integration has involved a continually evolving process of constitution making. A group of leading scholars argue that the shift towards constitutional issues is rooted not only in the issues on the European level, but also in shifting models of political and economic organisation in the member
states. Paradoxically, however, this push towards integration is accompanied by a number of institutional changes and political decisions, which challenge the picture of on-going integration, and indicate a shift towards a new pluralism in the Euro-polity. The contributors address questions such as; what
are the likely effects of the Amsterdam treaty changes in comparison with Maastricht?; how will these changes effect the complex balance among the governing institutions of the EU?; and what will be the implications for the lingering quest for democracy?
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
states. Paradoxically, however, this push towards integration is accompanied by a number of institutional changes and political decisions, which challenge the picture of on-going integration, and indicate a shift towards a new pluralism in the Euro-polity. The contributors address questions such as; what
are the likely effects of the Amsterdam treaty changes in comparison with Maastricht?; how will these changes effect the complex balance among the governing institutions of the EU?; and what will be the implications for the lingering quest for democracy?
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Der Amsterdamer Vertrag von 1997 und die Europapolitik
Karlheinz Neunreither, Antje Wiener (Herausgeber): European Integration After Amsterdam. Institutional Dynamics and Prospects for Democracy. Oxford University Press, Oxford 2000. 384 Seiten, 18,99 Pfund.
Mit dem Amsterdamer Vertrag haben die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union nach der Einheitlichen Europäischen Akte (1986) und dem Maastrichter Vertrag (1991/92) dem europäischen Vertragswerk ein drittes zentrales Dokument hinzugefügt. Neunreither und Wiener stellen die Veränderungen und Reformen der Vertragsartikel zur Diskussion, die die künftigen Handlungsfelder und Instrumente der Union festlegen soll(t)en. Kern der Argumentation: Mit Amsterdam vollzieht die Union einen qualitativen Schritt in Richtung Verfassungskonkretisierung, der vor allem auf einen politischen und ökonomischen Paradigmenwechsel in den Mitgliedstaaten zurückzuführen ist. Paradoxerweise ist der neuerliche Integrationsschub mit einer Reihe von institutionellen Veränderungen und politischen Entscheidungen verbunden, die gleichzeitig einen neuen Pluralismus in der Europapolitik signalisieren.
Dieser scheinbar widersprüchlichen Entwicklung gehen mehrere Autoren durch eine Analyse des Vertrages nach. Gefragt wird nach dem neuen "institutionellen Gleichgewicht" beziehungsweise der "Effizienz" im Entscheidungsprozess, nach der Perspektive für eine "Legitimitätsgewinnung" durch Verbesserung der demokratischen Verfahren, nach mehr "Flexibilität" als künftiges Strukturprinzip für die Union zur Steigerung der Problemlösungskapazität in einer Gemeinschaft mit 20 und mehr Mitgliedern und schließlich nach der "Finalität" der Union im Lichte der aktuellen Verfassungsdiskussion.
Eine angemessene Bilanz zur Ausweitung der Handlungsfelder der Union bleibt leider aus. Eher beiläufig erfährt der Leser von der Verfeinerung intergouvernementaler Ansätze in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik oder von der Vergemeinschaftung zentraler Bereiche aus der Dritten Säule "Inneres und Justiz" (so in der Asyl- und Einwanderungspolitik).
Im ersten, mit den Institutionen befassten Kapitel liefern Falkner und Nentwich eine solide Bestandsaufnahme zum neuen "institutionellen Gleichgewicht": Mit der Ausweitung der Mitentscheidungsverfahren nach Artikel 189 b wurde das Europäische Parlament entscheidend gestärkt. Es ist nun als Gesetzgeber mit dem Rat in allen Phasen der vereinfachten Entscheidungsprozedur gleichberechtigt und gleichgewichtig. Auch die Kommission hat ihre Stellung wegen der Positionsstärkung des Präsidenten sowie der Ausweitung des Handlungsfelds und der Mitgestaltungsrechte in zentralen Phasen der Initiative und des "opting out" weiter verbessert. Der Rat hingegen büßt seine Vormachtstellung insofern ein, als er nicht länger in der Lage ist, den beiden anderen Organen seine Position "aufzuoktroyieren". Diese Sichtweise überrascht angesichts der Tatsache, dass der Rat sich wesentliche Funktionen der Vertrags-/Verfassungsfortschreibung nach wie vor selbst vorbehalten hat. So kann er jetzt einstimmig nach dem neuen Artikel 113 (5) die Anwendung der Gemeinschaftsverfahren ausdehnen.
Dass der oft mühselige Entscheidungsprozess in der Kommission nicht nur auf ein kompliziertes Interessengeflecht einer supranationalen Institution zurückzuführen ist, sondern auch von nationalen, regionalen bis lokalen Einflüssen abhängig ist, erörtert Azzi. Er sieht darin den Grund für die Ineffizienz der Brüsseler Entscheidungsprozesse: Die Direktiven sind häufig kompliziert und detailbefrachtet, so dass die Umsetzung auf nationaler Ebene zäh verläuft.
Im Kapitel über die Aussichten für eine weitere Demokratisierung der Union beklagt Neunreither das Fehlen einer europäischen Dimension im Hinblick auf das parlamentarische Mandat. Entscheidend für eine Europäisierung der politischen Debatten sei eine bessere zeitliche wie inhaltliche Koordinierung der Diskussionen der unterschiedlichen Lager auf europäischer Ebene. Nur so könne sich ansatzweise so etwas wie eine europäische Gesellschaft, ein europäischer Demos herausbilden. Beides ist laut Neunreither jedoch noch in weiter Ferne. Insofern wird der "demokratische Input" auch künftig über die Nationalstaaten erfolgen. Europäische Entscheidungen sind als Ergebnis eines Prozesses zu begreifen, bei dem Fragen über die demokratische Legitimität neutralisiert werden und die Europäische Union quasi als Regime aufzufassen ist.
Die Beiträge zum Thema "Flexibilität" und "Erweiterung" im dritten Kapitel gehören zum interessantesten Teil des Bandes. Stubb fordert angesichts der anstehenden Erweiterung der Union weniger exklusiv gedachte Integrationskerne als im Schäuble-Lamers-Papier von 1994 vorgeschlagen. Er wird darin durch Helen Wallace bestärkt, die vor einer "Club-Mitgliedschaft" angesichts der damit verbundenen Gefahr einer Verschärfung der "Asymmetrien" innerhalb der Gemeinschaft warnt. Die Sorge der Mitgliedstaaten, die sich an der Zusammenarbeit nicht beteiligen wollen, auf Dauer abgekoppelt zu werden, wird die Zustimmung beziehungsweise Tolerierung der engeren Zusammenarbeit erschweren. Eine bloße Kostenüberwälzung auf die Beitrittskandidaten, so führt Sedelmeier an, dürfe es angesichts dieser Asymmetrien deshalb nicht geben, auch wenn die Erweiterung für die Union eine Gratwanderung zwischen Identitätsstiftung und Interessenpolitik ist.
Im letzten Kapitel stellt Pollack zunächst einen Wandel in der Verfasstheit der Gemeinschaft fest, der von nationalen Impulsen ausgeht. Er sieht traditionell zwei Ordnungsmodelle für die Union am Werk: das "neoliberale" auf der einen und das eines "regulierten Kapitalismus" auf der anderen Seite. Mit Amsterdam habe sich ein drittes Modell herausgebildet, das er als "Blairsches" Modell bezeichnet und zwischen den beiden anderen ansiedelt. Shaw und Wiener konzentrieren sich auf die Frage nach den Chancen für die Herausbildung einer "europäischen Bürgerschaft". Plausibel erscheint in diesem Kontext die Warnung vor einem Finalitätsdenken. Europa ist seit 1957 unterwegs hin zu einer quasikumulierten Verfassung. Dieser Ansatz, aus der formlosen Idee eine formbare und geformte Wirklichkeit werden zu lassen, sollte weitergeführt werden durch das normative Konzept einer Bürgerschaft als "gelebte Vollmitgliedschaft" innerhalb der Gemeinschaft, diesseits von gemeinsamen Werten und Normen. Europa-Politik ist längst nicht mehr bloß Ausdruck des größten gemeinsamen Nenners nationaler Politiken, sondern routinierter, verselbständigter Prozesse auf Brüsseler Ebene.
STEFAN FRÖHLICH
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main