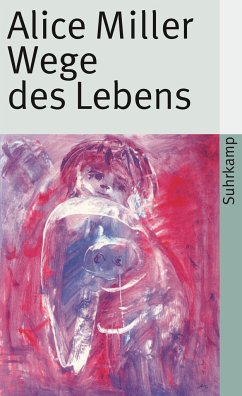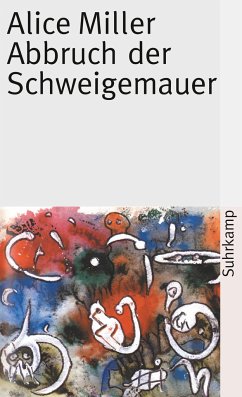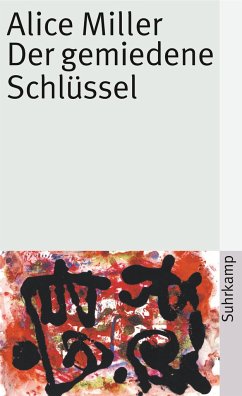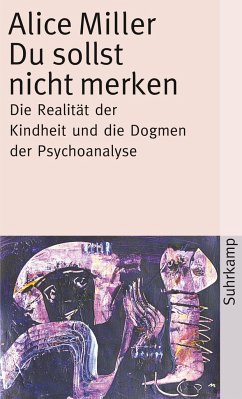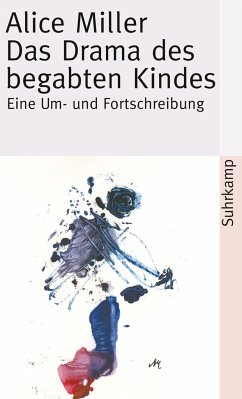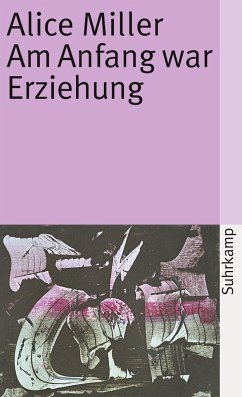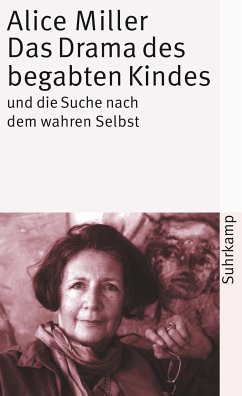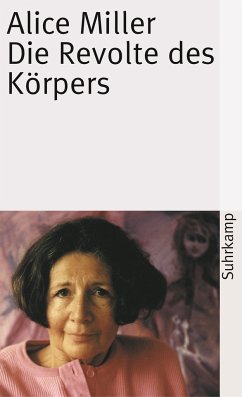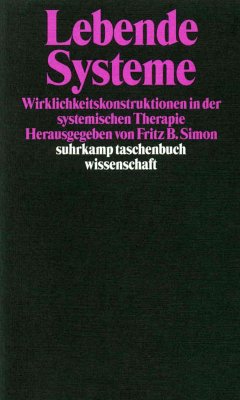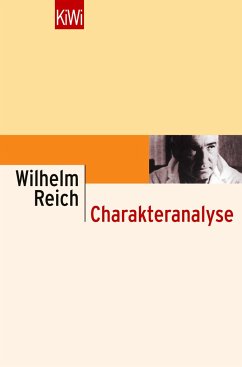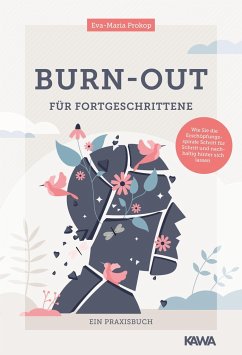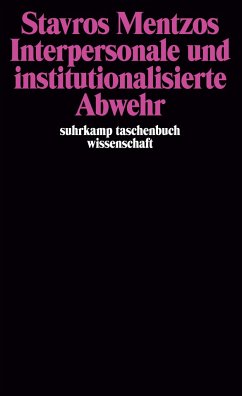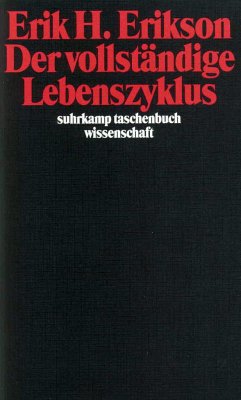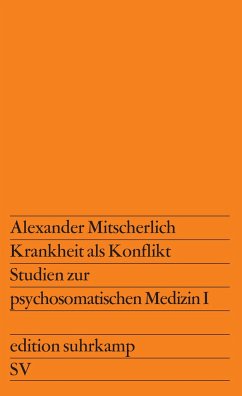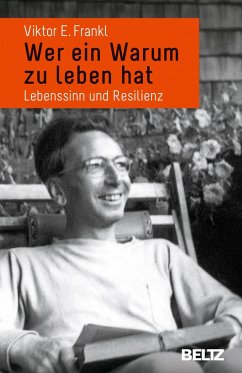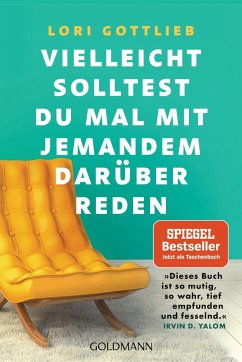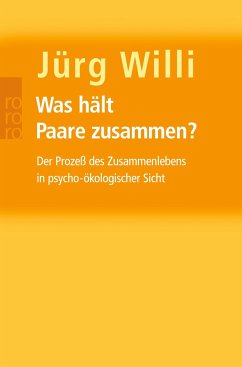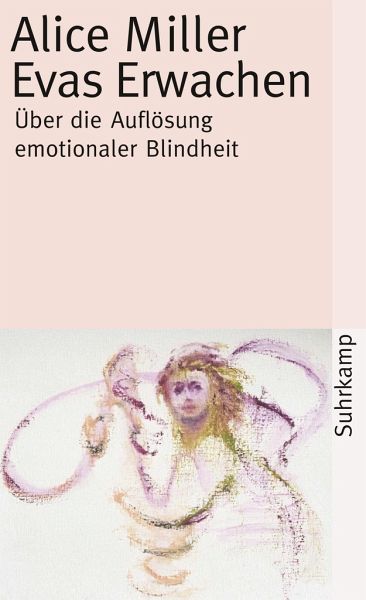
Evas Erwachen
Über die Auflösung emotionaler Blindheit

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
In all ihren Büchern seit dem Welterfolg Das Drama des begabten Kindes hat Alice Miller zu zeigen versucht, daß die an Kindern ausgeübte Gewalt irgendwann auf die Gesellschaft zurückschlägt. Die neuesten Entdeckungen über die Entwicklung des menschlichen Gehirns haben ihre analytischen Arbeiten inzwischen nicht nur vollauf bestätigt, sondern sie auch zum Weiterdenken angeregt. Die Erkenntnis, daß unser Körper ein vollständiges Gedächtnis unserer sämtlichen Kindheitserfahrungen enthält, die unser Bewußtsein allerdings leugnet, half ihr, die Dynamik der emotionalen Blindheit zu ver...
In all ihren Büchern seit dem Welterfolg Das Drama des begabten Kindes hat Alice Miller zu zeigen versucht, daß die an Kindern ausgeübte Gewalt irgendwann auf die Gesellschaft zurückschlägt. Die neuesten Entdeckungen über die Entwicklung des menschlichen Gehirns haben ihre analytischen Arbeiten inzwischen nicht nur vollauf bestätigt, sondern sie auch zum Weiterdenken angeregt. Die Erkenntnis, daß unser Körper ein vollständiges Gedächtnis unserer sämtlichen Kindheitserfahrungen enthält, die unser Bewußtsein allerdings leugnet, half ihr, die Dynamik der emotionalen Blindheit zu verstehen und ihre heutigen Vorstellungen über Psychotherapie in Evas Erwachen in einfacher, zugänglicher Form zu erklären.