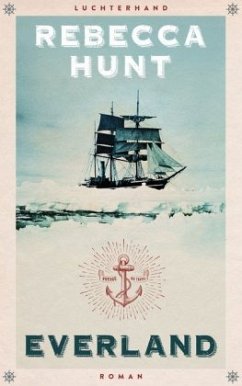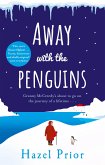Rebecca Hunts zweiter Roman ist Abenteuergeschichte, spannender Thriller und psychologisches Drama in einem. Die Insel Everland wird von zwei Antarktisexpeditionen erforscht, zwischen denen hundert Jahre liegen. Doch die Einsamkeit, die harten Wetterbedingungen und die feindseligen Kräfte der Natur sind heute wie damals bestimmend, und bei beiden Expeditionen zeigt sich: Die Antarktis enhüllt den wahren Charakter der Menschen, die sich ihr aussetzen.

© BÜCHERmagazin, Ulrich Baron (ub)

Die Schrecken des Eises und der Finsternis in der Antarktis: Rebecca Hunts Roman "Everland" zieht es in die Kälte.
In heißen Sommern tut es schon rein physisch gut, Bücher zu lesen, die einen schaudern und frösteln lassen. Rebecca Hunts zweiter Roman (in ihrem ersten, "Mr. Chartwell", legte sie den großen schwarzen Hund der Depression mit britischem Humor an die Kette) ist Abkühlliteratur. "Everland" handelt von jenen gefeierten, bemitleidenswerten Polarforschern, die bei minus dreißig Grad den Schrecken des Eises und der Finsternis trotzen: Robbenkadaver, heulende Schneestürme, tiefgekühlte Schlafsäcke, drangvolle Enge, erfrorene Glieder ("Polarstumpen"), Mägen, die sich wie "ein Knäuel gefrorenes Seil" anfühlen. Im Schelfeis der Antarktis gibt es keine Privatsphäre, selten Licht, keine Lebewesen außer Pinguinen, Seebären und schlecht gelaunten Wissenschaftlern.
In dieser unwirtlichen Umgebung werden Menschen auf letzte Fragen zurückgeworfen, die Lesern in gutgeheizten Stuben das Blut in den Adern gefrieren lassen: Darf man Schwache wie lästiges Gepäck oder abgestorbene Polarstumpen zurücklassen, damit die Starken schneller und besser vorankommen? Wo hören Menschlichkeit, Solidarität und britische Höflichkeit auf und fängt der nackte Kampf ums Überleben an? Am Ende schreiben die Sieger die Geschichte und entscheiden, wer als Feigling, Versager oder Held in sie eingeht. Rebecca Hunt, die achtunddreißigjährige Malerin aus London, ließ sich von der Diskrepanz zwischen den offiziellen Log- und unredigierten Tagebüchern von gescheiterten Polarforschern wie Scott und Shackleton zu "Everland" inspirieren.
Zwei jeweils dreiköpfige Expeditionsgruppen werfen im Abstand von hundert Jahren die Frage auf, welche Prioritäten wir im Leben und beim Sterben setzen wollen. 1913, bei der ersten "Everland"-Expedition, erforschen hartgesottene Entdecker die (fiktive) Vulkaninsel in der Antarktis. 2012, bei der Gedenkexpedition zum hundertsten Jubiläum, erforschen moderne Wissenschaftler, darunter zwei Frauen, den Klimawandel und setzen Pinguinen und Robben Mikrochips ein. Vor hundert Jahren gab es noch Segelschiffe und Schlittenhunde, heute motorisierte Quads und Satellitentelefone, aber an der Psychodynamik einer Dreiergruppe unter extremen Bedingungen hat sich wenig geändert und an den Gefahren auch nichts.
1913 stellt Lawrence, der Kapitän der "Kismet", die Everland-Erkundungstruppe zusammen. An der Spitze steht Napps, der fähige, aber allgemein unbeliebte Erste Offizier, ihm zur Seite der rohe, aber erfahrene und im Grunde gutmütige Matrose Millet-Bass; der Dritte im Bunde, der vertrottelte, weinerliche Dinners, ist überhaupt nur an Bord, weil sein reicher Onkel die Expedition und den Kapitän finanziell unterstützt. Als das Beiboot im Sturm kentert, wird der verletzte Dinners zum Klotz am Bein der anderen. Alles scheint auf eine klassische Polarforschertragödie zuzusteuern, aber es kommt anders: Der Versager wird, wenn auch nur vorübergehend, gerettet, Millet-Bass und Napps bleiben verschollen.
Hunt lässt anfangs vieles im Dunkeln; wie in einem guten Psychothriller oder einem Ibsen-Drama wird das ganze Drama nur scheibchenweise enthüllt, quasi von hinten aufgerollt. Parallel dazu, durch Cliffhanger, Leitmotive und gemeinsame Wahnvorstellungen geschickt ineinander verwoben, erzählt Hunt die Geschichte der Jubiläumsexpedition von 2012. Everland und die "Kismet" sind, nicht zuletzt durch die Verfilmung von Lawrences Buch, Legenden geworden, und doch entgeht niemand seinem Schicksal. Wieder geraten drei Polarforscher - ein Mann und zwei Frauen - auf Everland in Gefahr: Decker, der erfahrene Expeditionsleiter, Brix, die hochbegabte, aber in praktischen Dingen überforderte Wissenschaftlerin, und die junge ungeduldige Feldforscherin Jess.
Mit großer Sachkenntnis und einer klaren, schlichten Sprache beschreibt Hunt Landschaften und Stimmungen, Spannungen, Risse und ständig wechselnde Koalitionen innerhalb der Trios. 1913 ist es der unnahbare Napps, der langsam auftaut und sich fast widerwillig zum Fürsprecher des unmännlichen Dinners macht. Hundert Jahre später paktiert die selbstbewusste Praktikantin mit der Vaterfigur Decker gegen die tolpatschige Rivalin. Am Ende ist es der Mann, der den entscheidenden Fehler begeht, schlimmer: seine Schuld feige vertuscht, aber das ist Hunt kein weibliches Triumphgefühl wert. In der Antarktis wachsen die Flechten einen Millimeter pro Jahrhundert, und wütende Seebären verausgaben sich in Zweikämpfen mit anderen Bullen so, dass die Stärksten an Entkräftung sterben. Da sieht man die Dinge schon mal anders. Hunt war nie in der Antarktis und ließ sich mehr von Columbo-Krimis als von Polarheldengeschichten inspirieren, aber sie erzählt mit feinem Gespür und unsentimentalem Blick von den Ängsten und Albträumen ihrer Figuren, von ihren Zweifeln und ihrem Heimweh nach Frau, Kindern, grünem Gras. Müde alte Hasen und junge idealistische Hüpfer, abergläubische Spökenkieker und unterkühlte Wissenschaftler, Kapitän und Mannschaft, Frauen und Männer: Das Misstrauen ist in der Enge der Schiffe und Zelte mit Händen zu greifen. Aber wenn es um Leben und Tod geht, werden persönliche Empfindlichkeiten zurückgestellt und Geschlechter- und Klassenkonflikte auf einfache Fragen reduziert: Was ist uns ein Menschenleben wert? Soll man, wenn es keine Rettung mehr gibt, die Einsamkeit suchen oder lieber gemeinsam sterben?
Kapitän Lawrence fälschte den noblen Griesgram Napps zum Teufel um. Zeitungen und Tagebücher, ja selbst die menschliche Erinnerung können Dinge vergessen, verschweigen, verdrängen; aber die unerbittliche Natur und die Literatur bringen alles an den Tag: Lügen und Charakterschwächen, Loyalität, Opfermut. Wir sind nicht die Autoren unseres Schicksals, aber die Antarktis zeigt uns, "wer wir sind und welche Entscheidungen wir treffen". "Jeder Tag hat Konsequenzen", schreibt Hunt am Ende ihres schönen, klugen Romans, "auch wenn man sie nicht immer sieht."
MARTIN HALTER
Rebecca Hunt: "Everland". Roman.
Aus dem Englischen von Pociao. Luchterhand Verlag, München 2017. 412 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Es ist ein Abenteuerbuch, das diesen Namen absolut verdient.« Westdeutsche Allgemeine Zeitung