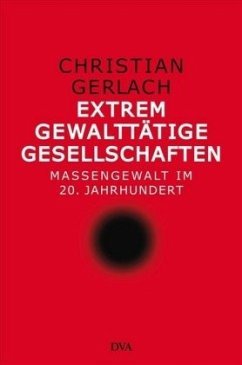"Die immer wieder und zu Recht eingeforderte Überwindung nationalgeschichtlicher und eurozentrischer Begrenzungen der Geschichtsforschung - hier wird sie eindrucksvoll, mit stupender Gelehrsamkeit vollzogen. [....] Gerlachs Buch ist ein eminent politischer Kommentar zur aktuellen Weltlage. Immer steht die Sache im Vordergrund, der empirische Befund und nicht die These." -- Die Zeit
"Wer das Phänomen Massengewalt verstehen will, der kommt um diese 575 Seiten nicht herum." -- Tages-Anzeiger, 30.06.2011
"Dieses Buch ist der gelungene Versuch aus wissenschaftlicher Sicht heraus das Phänomen von Massengewalt zu erklären. Der Autor dringt vor zu den Wurzeln, dorthin wo die Scheußlichkeit der Massenvernichtung seinen Anfang nimmt." -- buecherveraendernleben.npage.eu, 20.07.2011
Die bahnbrechende Studie zur Massengewalt im 20. Jahrhundert
Massengewalt zählt zu den verstörendsten Phänomenen der Gegenwart. Während herkömmliche Erklärungsversuche vor allem die Rolle des Staats und der ideologischen Voraussetzungen untersuchen, fragt Christian Gerlach nach den sozialen Bedingungen der Massentötungen. Anhand von Geschehnissen u.a. in Armenien, Bangladesch, Griechenland und Indonesien untersucht Gerlach die Bedeutung sozioökonomischen Drucks und sozialer Mobilität in betroffenen Gesellschaften. Aus ihnen folgen vielfältige Motive für Gewalt. Begriffe wie »Genozid« oder »ethnische Säuberung« verschleiern in ihrer Eindimensionalität die Unterschiedlichkeit der Gewaltakte, der Täter und Opfer. Mit seiner differenzierten Analyse leistet Christian Gerlach einen wichtigen Beitrag zur zeithistorischen Aufklärung.
"Wer das Phänomen Massengewalt verstehen will, der kommt um diese 575 Seiten nicht herum." -- Tages-Anzeiger, 30.06.2011
"Dieses Buch ist der gelungene Versuch aus wissenschaftlicher Sicht heraus das Phänomen von Massengewalt zu erklären. Der Autor dringt vor zu den Wurzeln, dorthin wo die Scheußlichkeit der Massenvernichtung seinen Anfang nimmt." -- buecherveraendernleben.npage.eu, 20.07.2011
Die bahnbrechende Studie zur Massengewalt im 20. Jahrhundert
Massengewalt zählt zu den verstörendsten Phänomenen der Gegenwart. Während herkömmliche Erklärungsversuche vor allem die Rolle des Staats und der ideologischen Voraussetzungen untersuchen, fragt Christian Gerlach nach den sozialen Bedingungen der Massentötungen. Anhand von Geschehnissen u.a. in Armenien, Bangladesch, Griechenland und Indonesien untersucht Gerlach die Bedeutung sozioökonomischen Drucks und sozialer Mobilität in betroffenen Gesellschaften. Aus ihnen folgen vielfältige Motive für Gewalt. Begriffe wie »Genozid« oder »ethnische Säuberung« verschleiern in ihrer Eindimensionalität die Unterschiedlichkeit der Gewaltakte, der Täter und Opfer. Mit seiner differenzierten Analyse leistet Christian Gerlach einen wichtigen Beitrag zur zeithistorischen Aufklärung.

Christian Gerlach will die Gewaltexzesse des 20. Jahrhunderts deuten. Den Urgrund sieht er in einem "kapitalistischen Weltsystem" - was wenig erklärt.
Von Christian Hartmann
So viel Gewalt wie im 20. Jahrhundert war noch nie. Das eröffnet viele Fragen - nach wie vor: Lässt sich dieser Ausbruch an Gewalt, einzigartig in seinem Umfang und in seinem Charakter, strukturieren, erklären, möglicherweise sogar zurückführen auf wenige zentrale Voraussetzungen? Genau dies hat Christian Gerlach versucht. Sein Paradigma der "extrem gewalttätigen Gesellschaften" überprüft er an mehreren Fallstudien - den Gewaltexzessen in Indonesien 1965/66, der Vernichtung der Armenier 1915 bis 1923 und dem Massenmord in Bangladesch 1971 bis 1977. Drei weitere Kapitel beschäftigen sich mit den Prinzipien der Guerrillabekämpfung, mit den Folgen, welche die deutsche Besatzung für Griechenland hatte, und schließlich der Frage, wieweit die Perspektive einer traditionellen Nationalgeschichte der Schilderung von Genoziden noch gerecht wird.
Dies ist eine recht unkonventionelle Auswahl und auf jeden Fall ein Beleg dafür, dass die deutsche, die sowjetische oder chinesische Geschichte nicht ausreichen, um die ideologisch-politischen Mordkampagnen des 20. Jahrhunderts in ihrer Gesamtheit darzustellen. Die Geschichte des großen Tötens war ungleich vielfältiger, komplizierter, und sie beanspruchte viel mehr Schauplätze, als es auf den ersten Blick scheint. Dass dies Buch daran erinnert, ist gut. Wieweit ist denn das, was etwa in Indonesien oder im Unabhängigkeitskrieg Ostpakistans, dem späteren Bangladesch, passierte, bei uns wirklich bekannt? Gerlach geht es freilich weniger um den Transfer von Wissen, ihm geht es in erster Linie um Analyse, um die Frage, wie es überhaupt zu diesen Katastrophen kommen konnte. In ihnen sieht er nicht allein ein Ergebnis staatlichen Handelns. Ohne das Zutun vieler gesellschaftlicher Gruppen seien Massaker dieser Dimension nie möglich gewesen, so seine These. In Zeiten gesellschaftlicher Krisen bilden sich kurzfristige, aber mächtige gesellschaftliche Koalitionen der Gewalt, die dann ihre Mitmenschen zu Hunderttausenden oder auch Millionen vernichten. Mit anderen Worten: Es geht hier auch um eine Gesellschaftsgeschichte von Genozid und Massenmord.
Beschrieben wird dies nicht besonders übersichtlich und flüssig, dafür aber mit größtmöglicher Liebe zum Detail. Zu Recht plädiert Gerlach für einen weiten Opfer-Begriff: Zu den Opfern dürften nicht allein die Ermordeten gezählt werden, sondern auch jene, die erst nach diesen Gewaltausbrüchen, etwa infolge von Hunger und Flucht, starben. Die Zahlen sind beklemmend: In Indonesien wurden 1965/66 nach einem Putschversuch linksgerichteter Offiziere mindestens eine halbe Million Menschen umgebracht. Für die Zahl der Armenier, die während des Ersten Weltkriegs dem Genozid im Osmanischen Reich zum Opfer fielen, nennt Gerlach Schätzungen zwischen 300 000 und 1,5 Millionen Toten, während für Bangladesch Zahlen zwischen einer halben Million und 3 Millionen Opfern im Umlauf sind; wahrscheinlich ist eine Million.
Wieweit aber lassen sich diese Ereignisse als "historische Muster" begreifen? Was können sie zur Erklärung des mörderischen 20. Jahrhunderts beitragen? Zunächst einmal: Hier handelt es sich um Massengewalt in vormodernen, bäuerlichen Gesellschaften, deren Vorgeschichte, Verlauf und Ergebnisse sich aber gerade nicht verallgemeinern lassen. Für die killing fields, welche die großen rechts- und linksextremen Ideologien des 20. Jahrhunderts hinterließen, ist deren Erklärungswert außerordentlich begrenzt. Denn in Deutschland und in der Sowjetunion waren ganz andere Mechanismen am Werk, die entsprechenden Stichworte lauten: ein absolutes Machtmonopol an der Spitze, eine umfassende Bürokratisierung und eine totalitäre Ideologie. Dagegen konnte sich der Terror bei den von Gerlach präsentierten Gewaltorgien oft viel spontaner, autonomer und auch ungeordneter entladen.
Beispiele wie diese reichen also kaum aus, um die Rolle des Staates (und im Übrigen auch der Ideologie, von der in diesem Buch kaum die Rede ist) prinzipiell so niedrig zu veranschlagen, wie Gerlach dies tut. Seine im Grunde beliebige Auswahl repräsentiert bestenfalls Teilaspekte der Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts. Warum die Verbrechen des Nationalsozialismus nur am Rande gestreift und die des Kommunismus weitgehend ausgeblendet werden, bleibt ein Geheimnis. Noch problematischer aber scheinen die sozioökonomischen Erklärungsmuster, mit denen Gerlach operiert. Im Grunde steht dahinter die Vorstellung, das "kapitalistische Weltsystem", eine "Welt der Ungleichheit, Ungleichgewichte und Ausbeutung", sei gewissermaßen Urgrund für das große Morden - und zwar immer dann, wenn dieses System in eine seiner zyklischen Krisen gerate. Das sei natürlich auch, so der verschämte Hinweis, in sozialistischen Gesellschaften möglich, in letzteren "auch unter dem Druck des internationalen kapitalistischen Systems". Außerdem sei - so seine konsequente Fortführung derartiger Thesen - "die sozialistische Kapitalakkumulation ebenfalls durch ein massives Vorkommen von Massengewalt und Elend gekennzeichnet". Ein solches Weltverständnis scheint für die Deutung der Gewaltexzesse im 20. Jahrhundert nur sehr bedingt tauglich. Etwas aber kann es schon erklären: die Verzeichnungen, Brüche und auch Entgleisungen, die Gerlachs Buch durchziehen, so etwa wenn er die Verbrechen des Nationalsozialismus "nicht allein durch rassistische Einschätzungen bedingt" sieht, sondern auch durch die damals "blühende Korruption in NS-Deutschland". Geschmacklos schließlich ist sein Verdikt über die ausländische Intervention in Bosnien, die imperialistischen Charakter trage. Wohlgemerkt: Damit ist nicht die Intervention Serbiens gemeint, sondern die der UN. So viel für dieses Buch auch zusammengetragen wurde, es ist ein Steinbruch des Wissens geblieben. Von seinem Anspruch, Massengewalt im 20. Jahrhundert zu erklären, ist es jedoch weit entfernt.
Christian Gerlach: Extrem gewalttätige Gesellschaften. Massengewalt im 20. Jahrhundert.
Deutsche Verlags-Anstalt, München 2011. 576 S., 39,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Die immer wieder und zu Recht eingeforderte Überwindung nationalgeschichtlicher und eurozentrischer Begrenzungen der Geschichtsforschung - hier wird sie eindrucksvoll, mit stupender Gelehrsamkeit vollzogen. [....] Gerlachs Buch ist ein eminent politischer Kommentar zur aktuellen Weltlage. Immer steht die Sache im Vordergrund, der empirische Befund und nicht die These." -- Die Zeit
"Gerlach zeigt, wie sich aus ganz unterschiedlichen Interessen eine zeitweilige Koalition aus Militär, nationalistischen und islamischen Kräften bildete, die in der Lage war, den Massenmord zu verüben, und danach wieder auseinanderbrach. Der Blick auf die gesellschaftliche Dimension der Gewalt, so wie er ihn eröffnet hat, ist anregend und wird auch künftig wichtig sein." -- Süddeutsche Zeitung, 11.10.2011
"Wer das Phänomen Massengewalt verstehen will, der kommt um diese 575 Seiten nicht herum." -- Tages-Anzeiger, 30.06.2011
"Gerlach zeigt, wie sich aus ganz unterschiedlichen Interessen eine zeitweilige Koalition aus Militär, nationalistischen und islamischen Kräften bildete, die in der Lage war, den Massenmord zu verüben, und danach wieder auseinanderbrach. Der Blick auf die gesellschaftliche Dimension der Gewalt, so wie er ihn eröffnet hat, ist anregend und wird auch künftig wichtig sein." -- Süddeutsche Zeitung, 11.10.2011
"Wer das Phänomen Massengewalt verstehen will, der kommt um diese 575 Seiten nicht herum." -- Tages-Anzeiger, 30.06.2011
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Nicht mehr als "ein Steinbruch des Wissens" ist diese Studie Christian Gerlachs geblieben, so das Resümee des Rezensenten Christian Hartmann. Indem Gerlach auf die Massenmorde in Indonesien (1965/66), im Osmanischen Reich (1915 bis 1923) und in Bangladesch (1971 bis 1977) fokussiert, erinnere er zwar zu Recht daran, dass auch jenseits von Nazideutschland, der Sowjetunion und China im großen Stil gemordet wurde. Gerade die Tatsache aber, dass Gerlach die letztgenannten Schauplätze nahezu komplett ausklammert, verstört den Rezensenten dann doch. Auch wenn Hartmann die prinzipiellen Unterschiede zwischen den jeweils temporären Mordkoalitionen innerhalb der untersuchten Gesellschaften und ideologischen Massenmördern wie Hitler oder Stalin einleuchten, ist der Kritiker überzeugt, dass sich eine umfassende Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts auf mehr als die "im Grunde beliebige Auswahl" Gerlachs berufen muss. Und in den sozioökonomischen Deutungsmustern des Autors erblickt der Rezensent letztlich kaum mehr als schnöde Kapitalismuskritik. Hartmanns Fazit: Interessante Details seien durchaus zu erfahren; der selbst gestellte Anspruch, Massengewalt zu erklären, werde jedoch gründlich verfehlt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Wer das Phänomen Massengewalt verstehen will, der kommt um diese 575 Seiten nicht herum.« Tages-Anzeiger, 30.06.2011