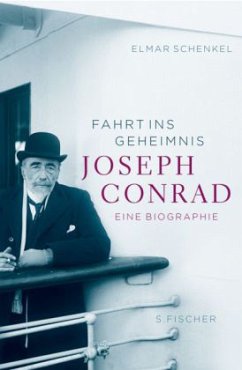Mit Werken wie "Herz der Finsternis" oder "Lord Jim" hat Joseph Conrad Klassiker der Weltliteratur geschrieben. Zum 150. Geburtstag erscheint jetzt eine neue Biographie, welche den Orten, Menschen und Themen nachgeht, die in Conrads Leben und Werk eine Rolle spielen. Wir erfahren von der Kindheit in Polen und der Entscheidung, zur See zu fahren. Wir begleiten ihn auf Reisen durch das Malayische Archipel und den Kongo, erleben seine ersten Versuche, in einer fremden Sprache zu schreiben, und lernen die Menschen kennen, mit denen er Umgang hatte. Gleichzeitig führt Elmar Schenkel in die wichtigsten Werke ein und beleuchtet die Hintergründe ihrer Entstehung und Themen. Entstanden ist eine lebendiges, stimmungsvolles und literarisches Porträt, das Mensch und Werk anschaulich werden lässt.

Zwei Reisen zu Joseph Conrad / Von Wolfgang Schneider
Geschwollene Hände und Beine, Rheuma, Neuralgie, schlechter Magen, Herzattacken, Erstickungsanfälle, Malaria, Verstopfung, Anämie oder einfach die Angst, wahnsinnig zu werden - es ist Kapitän Konrad Korzeniowski, der im Alter von gerade mal 34 Jahren diese Liste seiner Plagen führt. Ein Seemann, aber kein bärbeißiger. Sichtlich ist er gezeichnet von seiner Kongo-Expedition. Er hat Kuren nötig und denkt ans Aufhören. Segelschiffe haben keine Zukunft mehr.
Er will einen neuen Anfang setzen, mit der Literatur. Denn dieser Markt expandiert kräftig im letzten Jahrzehnt des vorletzten Jahrhunderts. Seit einiger Zeit trägt er, der sich nicht nur der Einfachheit halber Joseph Conrad nennt, auf seinen Reisen ein Manuskript mit sich, den Roman "Almayers Wahn". Daran arbeitet er, wenn in irgendeinem Hafen der Welt müßige Monate zu verbringen sind. 1895 erscheint das Buch; da ist der Autor im für heutige Begriffe besten Debütantenalter von siebenunddreißig Jahren.
Conrad meinte einmal, er habe "eine dreifache Persönlichkeit: polnischer Junge, Seemann, Brite zu Lande". Dank dieser Spannweite gibt sein Leben eine ideale Vorlage für Biographien ab. Das beweisen aufs Neue zwei lesenswerte Bücher, die zum 150. Geburtstag des Autors am 3. Dezember erschienen sind, mit Titeln, die von Conrad selbst sein könnten: "Fahrt ins Geheimnis" von Elmar Schenkel und "Im Spiegel der See" von John Stape.
Der britische Conrad-Spezialist Stape bietet eine gut geschriebene, in der Deutung bewusst zurückhaltende Darstellung. Angesichts der ausufernden Sekundärliteratur verzichtet er darauf, den "Zusammenhang von Leben und Werk" zu untersuchen. Conrads Weg zum Erfolgsautor, die Höhe seiner Honorare, die Reaktionen der Kritik, die Literaturbetriebsquerelen, ebender ganze Alltag eines Schriftstellers ist dagegen in allen Details dargelegt.
Stapes Verfahren bewährt sich vor allem im ersten Teil über die Leidensgeschichte des "polnischen Jungen". Sein Vater, Apollo Korzeniowski, war ein Übersetzer und politischer Literat. Und ein beinahe mittelloser Mann, nachdem wegen Unterstützung des polnischen Aufstandes von 1830 der Familienbesitz konfisziert worden war. Zur Taufe seines einzigen Kindes, "geboren im 85. Jahr der Moskowitischen Unterdrückung", verfasste er ein schwülstiges Gedicht. Es instruierte den Neugeborenen darüber, dass seine "Mutter im Grabe liegt" (gemeint war Polen), und verhieß ihm die "Krone des Märtyrertums".
Im Alter von sieben Jahren verlor der junge Conrad seine Mutter, vier Jahre darauf starb der Vater an der gleichen Krankheit: Tuberkulose. In einem anrührenden Selbstporträt beschreibt er, wie er sich als Junge in den Schlaf weint, während im Nebenzimmer allmählich das Leben des Vaters erlischt. "Eine unglückliche Kindheit ist nicht selten, doch im Vergleich mit Conrads frühen Jahren verblassen selbst Dickens' Erlebnisse in der Schuhputzerfabrik", schreibt Stape. Man mag hier die Grundlage für die Depressionen sehen, an denen Conrad zeitlebens litt.
Der Hafen von Marseille wurde für den Siebzehnjährigen das Tor zur Welt. Von hier aus unternahm er auf diversen Seelenverkäufern die ersten großen Reisen in exotische Fernen. Viele Gerüchte ranken sich um diese Jahre: unglückliche Lieben, Verstrickungen in Waffenschmuggel, ein Duell, das wohl eher ein Selbstmordversuch war. Die Telegraphendrähte glühten, wenn Onkel Tadeusz, Conrads Vormund und Lebensmensch, ihn aus der fernen Ukraine zurechtwies. In Briefen sprach er den jungen Mann mit "mein lieber Pessimist" an und empfahl ihm ein tätiges, pflichtenreiches Leben. Realismus kontra Romantik - eine Grundspannung von Conrads späteren Werken.
Durch sein distinguiertes Erscheinungsbild hob er sich ab von den meisten anderen Seeleuten. Er wirkte wie ein Dandy zu Schiff, mit Bowler, Handschuhen und Stock. Geschliffen ist auch sein Stil, ein mustergültiges, feinste psychische Nuancen auslotendes Englisch. Mancher, der ihn sprechen hörte, wunderte sich jedoch, dass "jemand mit einem so furchtbaren Akzent ein englisches Schiff befehligen konnte". Inzwischen haben Studien die "polnische Tiefenstruktur" seines Schreibstils herausgestellt. Polnische Leser finden seit je in "jedem Nieser" Conrads zahlreiche Echos der Herkunftswelt, spottete Gombrowicz einmal.
Die Methode des Leipziger Anglisten Elmar Schenkel ist nicht die lineare Erzählung, sondern das Annähern und Umkreisen von biographischen und thematischen Knotenpunkten. So wird der Conrad-Kosmos einleuchtend vermessen; der Leser erhält neben der Lebensgeschichte eine ausgezeichnete Hinführung zu den Werken. Gleich im ersten Absatz des Vorworts findet man eine komprimierte Charakterisierung von Conrads Erzählen: "Die Geschichten schwingen um ein offenes Zentrum, einen leeren Ort", der im Lesen nach Ausfüllung verlange. "Conrad macht den Leser zum Kollaborateur . . ." Abgesehen von ein paar kleinen stilistischen Macken, ist das Buch angenehm unakademisch geschrieben, obwohl es viel Forschung verarbeitet. Schenkel liebt geistvolle Querverbindungen - etwa zwischen dem Stauen einer Schiffsladung, die nicht zu tief liegen darf, und der richtigen Anlage eines Romans, was Beschreibung, Handlungsführung und Figuren betrifft.
"Herz der Finsternis" ist zugleich realistisch und phantasmagorisch. Schenkel sieht eine "Logik des Traums" am Werk, die sich "souverän der Partikel des Wirklichen bedient". Damit rückt Conrad in die Nähe Kafkas. Es entspricht einer erzählten Welt, in der das Böse als Spaltprodukt des Gutgemeinten alles kontaminiert und vormalige Helden zu Figuren des Zerfalls werden. "Rottet die Bestien alle aus", lautet Kurtz' handschriftlicher Nachtrag zu einem philanthropischen Text. "Ganz Europa trug dazu bei, Kurtz hervorzubringen" - er ist das Schreckensspiegelbild einer allzu sendungsbewussten Zivilisation.
Das Mysteriöse - bei Conrad wird es Ereignis. Seine Romane sind nicht auf den Punkt erzählt, sondern umkreisen ihn in einer unermüdlichen Bewegung, ergehen sich in obskuren Andeutungen, zelebrieren Widersprüche, bohren sich hinein in Vorgeschichten. Es ist eine Kunst des "delayed decoding", der verzögerten Entzifferung, am faszinierendsten wohl in "Lord Jim". Der Roman erschien im selben Jahr wie Freuds "Traumdeutung" und ist gleichsam mit Freud'schen Obsessionen gesättigt - Verdrängung, Scham, Schuld, Traum, Sublimation, Vaterfiguren. Thomas Mann sagte von diesem Buch, er würde es als erstes wieder anschaffen, wenn einmal seine Bibliothek zerstört würde. Realer Handlungskern ist die Dschiddah-Affäre, bei der eine Mannschaft ihr Schiff mit tausend Mekka-Pilgern an Bord in Seenot im Stich ließ. Dann war das Schiff aber doch nicht untergegangen, und die Wellen der Empörung über das unrühmliche Verhalten der Crew schlugen hoch.
In späteren Jahren war Kapitän Conrad ein begeisterter Automobilist, der hohe Geschwindigkeit liebte und eine Neigung zu Beinaheunfällen hatte. Der alternde, bewegungsunlustige, vom Kettenrauchen angegriffene Mann war mit seinen Gichtanfällen, seiner Gereiztheit und seinem desillusionierten Lebensgefühl jedoch nicht leicht zu nehmen. "Ärgerte er sich über etwas, schnippte er bei Tisch mit Brotbröckchen, und einmal, als ihm seine Frau Kalbskopf auftrug, weigerte er sich, davon zu essen, und drehte bockig seinen Stuhl herum, bis das missliebige Gericht entfernt war", schreibt Stape. In langen Briefen schilderte Conrad die Qualen seiner Schreibblockaden. Besonders das Finale der Romane machte ihm oft schwer zu schaffen, und er stöhnte wie Kurtz: "Die letzten 2000 Wörter! Das Grauen!"
Jede Epoche entdeckt ihren Conrad. Lange war er der Autor der einsamen, loyalen Männlichkeit, des stillen Heroismus und des Aushaltens. Heute gilt er als einer der Ersten, die Themen wie die Globalisierung ins Auge fassten. In "Der Geheimagent" verbindet er die Darstellung des Terrorismus mit einem Familienmelodram. Es gibt in diesem Buch einen nihilistischen Professor, der mit einem allzeit umgeschnallten Sprengstoffgürtel durch London läuft. Die letzten Sätze des vor genau hundert Jahren erschienenen Romans zielen in unsere Gegenwart: "Er hatte keine Zukunft. Er verschmähte sie. Er war eine Kraft. In Gedanken hätschelte er Bilder von Verderben und Zerstörung. Er ging dahin, zierlich, unscheinbar, schäbig . . . Niemand sah ihn an. Unbeachtet und todbringend wie die Pest schritt er durch das Menschengewühl der Straße."
Elmar Schenkel: "Fahrt ins Geheimnis. Joseph Conrad". Eine Biographie. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2007. 368 S., geb., 24,90 [Euro].
John Stape: "Im Spiegel der See". Die Leben des Joseph Conrad. Aus dem Englischen übersetzt von Eike Schönfeld. Marebuchverlag, Hamburg 2007. 543 S., geb., 33,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Anlässlich des 150. Geburtstags von Joseph Conrad sind zwei Biografien erschienen, die John von Düffel in Augenschein genommen hat. Elmar Schenkel versucht sich dem sein Leben stets aufs Neue mystifizierenden und verschleiernden Schriftsteller auf assoziativen, Exkursen folgenden Wegen anzunähern, konstatiert der Rezensent, der eingenommen feststellt, dass der Autor dabei gar nicht den Anspruch hat, das "Rätsel" Conrad vollständig zu lösen. Sehr angemessen findet Düffel die Metapher der Reise, die das Leben zwischen Wirklichkeit und Fiktion des aus Polen stammenden Kapitäns, der seine Bücher auf Englisch verfasste und sich eine ganz neue Identität auf den Leib schrieb, zu fassen sucht. Schenkel ist deutlich mit der Fabulierlust und der Faszination an den Übergängen von Traum und Wirklichkeit infiziert, die so markant das Werk Conrads prägen, stellt der Rezensent wohlwollend fest, dem allerdings auffällt, dass Schenkel beredte Spurensuche auch dann nicht ins Stocken gerät, wenn er nicht auf biografische Fakten zurückgreifen kann.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH