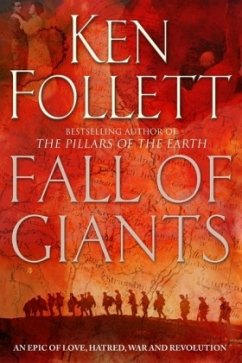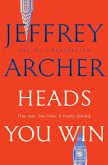Ken Follett folgt fünf Familien durch die welterschütternden Ereignisse des Ersten Weltkriegs, der Russischen Revolution und den Kampf um das Wahlrecht für Frauen. Eine Geschichte von verblüffender Komplexität, die uns von Washington nach St. Petersburg führt, vom Schmutz der Kohleminen zu den glitzernden Kronleuchtern der Paläste und von den Korridoren der Macht in die Schlafzimmer der Mächtigen. Der Auftakt einer fulminanten Trilogie über das 20. Jahrhundert.

Braucht die Welt eine weitere Romanschwarte von Ken Follett? Und auch noch eine über den Ersten Weltkrieg? Unbedingt: In diesem Riesenwerk ergänzen sich Unterhaltung und historischer Unterricht perfekt.
Das hat es hierzulande nach Erich Maria Remarques "Im Westen nichts Neues" aus dem Jahr 1929 oder Ernest Hemingways "In einem anderen Land" von 1930 nicht mehr gegeben: Seit seinem Erscheinen vor gerade einem Vierteljahr steht mit Ken Folletts "Sturz der Titanen" ein Roman auf den allerersten Plätzen der Publikums- und Käufergunst, dessen Thema der Erste Weltkrieg ist - und das über gut tausend Seiten hinweg. Bis Weihnachten werden annähernd 600 000 Exemplare verkauft sein.
Das ist mehr als erstaunlich. Was immer die deutschen Romanleser in den vergangenen Jahrzehnten auch beschäftigt und angezogen hat: Die Zeit zwischen 1914 und 1918/19 gehörte gewiss nicht dazu. Für die deutschen Schriftsteller gilt das nicht minder. Der Erste Weltkrieg blieb den Historikern überlassen, in der Folge von Fritz Fischers "Griff nach der Weltmacht" von 1961 auch dem politischen Diskurs.
Ganz anders in Großbritannien. Dort ist der Erste Weltkrieg im kollektiven Gedächtnis "The Great War" geblieben - und mit ihm geblieben sind jene zeitgenössischen "War Poets" wie Rupert Brooke, Wilfred Owen oder Siegfried Sassoon, die bis heute in keiner Lyrik-Anthologie fehlen. Bis heute aber ist diese Vergangenheit auch eine ganz aktuelle literarische Herausforderung. William Boyd, Louis de Bernieres und Pat Barker haben sich in jüngerer Zeit mit ihr auseinandergesetzt. "Birdsong" heißt der 1993 erschienene Roman von Sebastian Faulks über die Westfront. In England sofort ein Spitzentitel, ist das Buch inzwischen ein veritabler Longseller - von der deutschen Übersetzung hingegen ("Gesang vom großen Feuer", 1997) nahm nahezu niemand Notiz.
Natürlich liegt es auf der Hand, warum mit dem Ersten Weltkrieg in unseren Breiten literarisch wie verlegerisch nichts zu gewinnen ist - Deutschland hat ihn nicht nur verloren, sondern sich als fatale Konsequenz aus der "Urkatastrophe des Jahrhunderts" (George F. Kennan) mit dem Nationalsozialismus, dem von ihm entfesselten Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust noch gewaltigere Untergänge und für immer gegenwärtige Verbrechen eingehandelt. Damit hat sich unsere Literatur seit 1945 befasst - und eindrückliche Zeugnisse hervorgebracht. Als literarisches Sujet erlosch der Erste Weltkrieg hingegen mit dem Tod jener Autoren, die als Soldaten noch an ihm teilgenommen hatten - Ernst Jünger, der 1998 mit 102 Jahren starb, war bei weitem der Letzte unter ihnen.
Warum also interessieren sich die bis dato 550 000 Leser, die Folletts "Sturz der Titanen" zum stattlichen Preis von 28 Euro erworben haben, nun plötzlich wieder brennend für das Attentat auf den österreichischen Thronfolger, den Schlieffen-Plan, die Schlachten von Tannenberg oder an der Somme, für den Kampf um Verdun oder den uneingeschränkten U-Boot-Krieg?
Zunächst begeistern sie sich gewiss für den inzwischen einundsechzig Jahre alten Ken Follett, der aktuell und weltweit mal wieder auf einer enormen Erfolgswelle schwimmt. Der Fernsehvierteiler seines Mittelalter-Epos "Die Säulen der Erde" hat nicht nur Sat.1 pro Folge zwischen sechs und acht Millionen Zuschauer beschert, sondern auch den amerikanischen, britischen, ja selbst asiatischen Sendern stattliche Quoten eingetragen. "Sturz der Titanen", der neue Roman, stand in allen großen Leseländern wenigstens vorübergehend auf Platz eins, nirgendwo allerdings so stabil wie bei uns.
Folletts Erfolg hat seit dem Thriller "Die Nadel" von 1978 stets sehr viel mit Handwerk zu tun. Seine Leser wissen einfach, dass sie sich auf ihn verlassen, dass sie ihm trauen, ja vertrauen können. Nie würde er ihnen blinde Motive, verschachtelte Handlungsgänge oder ein ungenügend beglaubigtes Personal zumuten. Gerade seine historischen Romane entwirft er generalstabsmäßig. Anders aber als bei allen Generalstäben des Ersten Weltkriegs, deren fehlerhafte Einschätzungen ein latentes Strukturchaos an Schlachten und Stellungen produzierten, ist sein Vorgehen im Zentrum des Geschehens wie an dessen Flanken stets wohlüberlegt und zielgerichtet - nicht umsonst bedankt er sich am Ende auch dieses Buches bei einer stattlichen Zahl an wissenschaftlichen Zuträgern und kulturkundigen Rechercheuren, selbst ein Experte für Lokomotivräder war in seinem Team.
Follett plant und kalkuliert exakt: Nach jeweils siebzig, achtzig Seiten ist unbedingt wieder eine Liebes-, besser noch eine Sexszene fällig; nach drei oder vier Kapiteln braucht es einen Wechsel des Handlungsortes, kein Satz darf länger als zwei, drei Zeilen sein, Hypotaxen sind verpönt. Dennoch wirkt das narrative Vorgehen nie schematisch, gar fabrikhaft. Dieser Erzählgeneral, Romaningenieur und Plotmanager hat eben auch ein untrügliches Gespür vor allem für die Wahl, die Charakterisierung und das Zusammenspiel seiner Hauptfiguren.
Im "Sturz der Titanen" sind es acht. Jede von ihnen ist sozial, regional oder national genau lokalisiert, gewinnt just darüber eine unverwechselbare Identität und lädt gerade deshalb die unterschiedlichsten Leser - so sie nicht gleich das ganze Ensemble ins Herz schließen - mindestens zu punktuellen Identifikationen ein. Da gibt es Billy Williams, den jungen Proletarier aus dem walisischen Bergwerk, der an der Westfront zur widerständigen Führungsfigur reift. Es gibt seine Schwester Ethel, die erst dem Hochadel dient und sich dann auf die eigenen Füße stellt. Ein Geschwisterpaar steht auch für die Würde, die Marotten und die Widersprüchlichkeiten der englischen Adelselite: Earl Fitzherbert, genannt Fitz, ein vollendet charmanter und vollkommen reaktionärer Grundherr und Offizier, Lady Maud andererseits, eine hochgebildete und naturgemäß schöne Suffragette mit klarem Zukunfts- und Fortschrittsblick.
Das britische Stammpersonal ergänzen und kontrastieren zwei russische Brüder: Grigori Peschkow, der lautere Revolutionär aus St. Petersburg, alsbald Petrograd, und Lew, ein Hallodri, Tunichtgut und Frauenschwarm vor dem Herrn, der in Amerika eine russenmafiose Karriere hinlegt. Zwei Einzelkämpfer vollenden das Figurenzentrum. Einmal der Millionärs- und Senatorensohn Gus Dewar aus Buffalo im Staate New York - zum anderen Walter von Ulrich, der junge deutsche Militärattaché in der Londoner Botschaft.
Ohne Zweifel ist dieser Walter Ken Folletts verblüffendster Wurf: ein nachdenklicher, empfindsamer, von Anfang an kriegsskeptischer, auch deshalb hochsympathischer Held ohne jede Hunnenhaftigkeit, ein strahlender Vorbilddeutscher in finsterster Zeit. Und das im Roman eines Briten! Selbstredend hat Follett bei dieser Figur an seine treuesten, eben an seine deutschen Leser gedacht, aber nicht einmal dieses Kalkül nimmt man ihm übel. Und nicht unfreudig in Kauf nimmt man, dass Walter sogleich auch das Herz und den Verstand von Lady Maud gewinnt.
Überdies darf man es Kunstfertigkeit nennen, wie leichthin und selbstverständlich Follett sein fiktives Personal mit den weltpolitisch und militärisch handelnden Realfiguren der Zeit verbindet. So assistiert Walter General Ludendorff bei Tannenberg, Gus Dewar arbeitet im Büro des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson, Grigori versteckt den aus der Schweiz zurückgekehrten Lenin und ist später in Trotzkis engstem Bürgerkriegsstab. Jederzeit können die Fitzherberts mit den britischen Premiers Asquith und Lloyd George parlieren oder sich mit dem aufstrebenden Winston Churchill streiten.
Fiktives wirkt auf solche Weise real, das Reale gleichwohl nicht zweck- und zwanghaft fiktionalisiert. Unterhaltung und Unterrichtung der Leser stimmen bei Follett überein. Schönfärben, die Hauptaktivität des Trivialromans, ist seine Sache nicht, auch für die Menschenverachtung der Kriegsherrn und das Grauen der Materialschlachten findet sein so anonymer wie allwissender Erzähler eine angemessene, mithin realistische Sprache.
Was unterscheidet diesen handwerklich perfekten Roman dann noch von wirklich großer Kunst? In Thomas Manns Erzählung "Tonio Kröger" heißt es vom Tanzlehrer François Knaak, er sei so beliebt, weil er eben "nicht in die Dinge hinein" schaue, ihnen nicht wirklich auf den Grund gehe. Diese Bewandtnis hat es auch mit dem Groß-Schriftsteller Ken Follett: Er zeigt uns die Welt und deren Akteure konsequent und ausschließlich nur von außen. Das limitiert sein erzählerisches Vermögen und macht ihn beliebt. Andererseits aber gibt er den Lesern so auch die Freiheit, die Leerstellen seines Schreibens mit ihrer eigenen Phantasie zu füllen. Das ist ja nicht wenig. Und weil das so ist, folgen sie diesem Autor auch dann, wenn er den Schlieffen-Plan etwas papieren erläutert oder seinen Figuren bisweilen Leitartikel in den Mund legt.
"Sturz der Titanen", hat Follett in vielen Interviews bekundet, ist der erste von drei Teilen einer "Saga" des zwanzigsten Jahrhunderts. Der zweite Teil wird vom Zweiten Weltkrieg handeln, der dritte vom Kalten Krieg. Erzählziel ist der Mauerfall in Berlin. Follett, das ist bei seiner Arbeitswut und Arbeitsgenauigkeit ziemlich sicher, wird sein Ziel erreichen. In den literaturfernen Ersten Weltkrieg folgen ihm seine Leser schon. Warum sollen sie den Lesemarsch nicht bis zum 9. November 1989 durchhalten?
JOCHEN HIEBER
Ken Follett: "Sturz der Titanen". Roman.
Aus dem Englischen von Rainer Schumacher und Dietmar Schmidt. Bastei Lübbe, Köln 2010. 1024 Seiten, 28,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Like Follett's classic novel, Pillars of the Earth, it quickly becomes a guilty pleasure. Daily Telegraph
Few works set out with such a grand concept as Ken Follett's new Century trilogy, but part one suggests that the series will be one of the literary masterpieces of our time Sunday Times