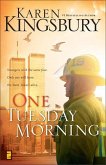Ein kühnes Meisterwerk - Don DeLillos großer Roman über den 11. September New York am 11. September. Eine Stadt in Asche und Rauch. In eindringlichen Bildern zeichnet Don DeLillo den Ablauf der Ereignisse nach: von den Tätern zu den Opfern, von Hamburg nach New York. Erzählt wird das Leben einer Familie, die berührende Geschichte einer Liebe, der Alltag nach der Katastrophe.Keith Neudecker, der im World Trade Center gearbeitet hat, kann sich am 11. 9. aus einem der brennenden Türme retten. Er sieht, was geschieht, ohne es zu begreifen, und schlägt sich wie in Trance zu seiner Ex-Frau Lianne und seinem kleinen Sohn Justin durch. In ihrer Verzweiflung klammern sich Keith und Lianne aneinander, sie wollen aus der Einsamkeit der Angst in ein gemeinsames Leben zurückfinden. Gespräche, vor allem in Liannes Familie, kreisen um den Schock, um den Terrorismus als ständige Bedrohung. Justin und seine Freunde versuchen im Spiel ihre Angst vor den Terroristen zu überwinden. Keith durchlebt immer wieder das Trauma der Flucht aus den Türmen, und Lianne irrt ziellos durch die Stadt. Und dann sieht sie voller Entsetzen Falling Man, einen Performance-Künstler. Nur mit einem Seil gesichert, stürzt er sich als Chronist des Zeitalters des Terrors hoch oben von den Wolkenkratzern in die Tiefe. Der Terror bestimmt die Realität.»Falling Man« ist ein weiterer Höhepunkt in DeLillos Werk. Von Neuem beweist der Autor, wie scharfsinnig und zugleich sensibel er einschneidende Ereignisse wahrnimmt. Mit großer sprachlicher Kunst und Prägnanz gelingt es Don DeLillo, das scheinbar Unsagbare überzeugend in Worte zu fassen.Die Originalausgabe des Romans erschien am 15. 5. 2007 in den USA.

Don DeLillos neuer Roman "Falling Man" nähert sich den Anschlägen des 11. September über eine Familiengeschichte. Doch tatsächlich ist das Buch eine Reflexion über Macht und Ohnmacht der Kunst im Angesicht des Schreckens.
Von Richard Kämmerlings
Im November 2001 veröffentlichte die polnische Dichterin Wislawa Szymborska in dieser Zeitung ein Gedicht mit dem Titel "Fotografie vom 11. September"; die Übersetzung stammte von Karl Dedecius: "Sie sprangen von brennenden Stockwerken abwärts - / einer, zwei, noch einige / höher, tiefer // Die Fotografie hielt sie lebend fest, / und nun bewahrt sie sie auf / über der Erde zur Erde // Jeder ist noch ein Ganzes / mit eigenem Gesicht / und gut verstecktem Blut", so die ersten drei von sechs Strophen. Das Gedicht ist eine Bildbeschreibung, es bezieht sich auf die schockierenden Aufnahmen von Menschen, die aus den Türmen des World Trade Center sprangen.
Das berühmteste, zur Ikone des Schreckens gewordene Foto stammt vom AP-Fotografen Richard Drew. Es erschien am 12. September in vielen Zeitungen, auch in der "New York Times", und seine Wirkung beruhte vor allem auf dem Kontrast zwischen den furchtbaren Geschehnissen und der makellosen Ästhetik des Bildes - und des Sprunges selbst. Mit dem Kopf voran, mit angelegten Armen und einem angewinkelten Bein scheint der "Falling Man" wie ein professioneller Turmspringer eine einstudierte Choreographie auszuführen. Der Sprung wirkt wie ein künstlerisches Statement, wie ein provokativer Kommentar zum tausendfachen Tod. Drews perfekt komponiertes Foto verdoppelt diesen verstörenden artistischen Charakter noch einmal, und das Gedicht der Szymborska macht daraus schließlich eine metaphysische Reflexion über die Macht und Ohnmacht der Kunst angesichts der sterbenden Menschen. Die letzte Strophe lautet: "Zwei Dinge nur kann ich für sie tun - / diesen Flug beschreiben / und den letzten Satz nicht hinzufügen." Indem Gedicht und Foto den Augenblick vor dem Aufprall festhalten, nähren sie die Illusion, die Zeit besiegen zu können: Der "Falling Man" ist noch nicht tot.
In Don DeLillos neuem Roman gibt es den Performancekünstler David Janiak, der hier in den Wochen und Monaten nach dem 11. September in halsbrecherischen öffentlichen Aktionen den Fall dieses "Falling Man" nachstellt. Von fast unsichtbaren Seilen gehalten, provoziert er die traumatisierten New Yorker; wie in einer kollektiven Psychotherapie ruft er die Schreckensbilder immer wieder in Erinnerung. Im Zentrum dieses Romans steht somit ein fixierter, der Zeit enthobener Moment, das Bild eines ewigen, nie an ein Ende kommenden Fallens - und damit im Grunde ein antinarratives Prinzip. Keine Story, kein Vorher und Nachher, sondern ein Still.
Die Reaktionen auf DeLillos Buch waren womöglich auch deswegen so zurückhaltend, weil man dieser Tiefenstruktur nicht ausreichend Beachtung schenkte und der auf den ersten Blick sehr private Plot in der Statik ein zu großes Gewicht bekam. Ausgangspunkt der Geschichte ist eine unerwartete Familienzusammenführung: Der im World Trade Center arbeitende Immobilienmakler Keith Neudecker kehrt wie in einem Reflex zu seiner Frau Lianne und seinem kleinen Sohn Justin zurück, nachdem er dem Inferno leicht verletzt entronnen ist. Der Roman setzt mit der atemberaubenden Szene ein, wie Neudecker, eine Aktentasche in der Hand und blutüberströmt, sich durch das Chaos zu seinem früheren Heim durchschlägt, wo er schon lange nicht mehr wohnt. Erst später erfahren wir, was genau ihm zuvor widerfahren ist. Denn das Blut ist nicht seines, und auch die Aktentasche gehört nicht ihm. Erst in der Schlussszene, die den Kreis schließt, wird das volle Bild sichtbar.
Erzählt wird abwechselnd aus der Sicht Neudeckers und der seiner Frau. Vor allem Liannes Blick fällt auf weitere Figuren und deren Reaktionen auf den 11. September: ihren Sohn Justin, der sich mit Freunden eine verzerrte Privatmythologie zusammenbastelt und nach weiteren Terrorflugzeugen Ausschau hält, Liannes Mutter, deren aus Deutschland stammender Liebhaber, heute Kunsthändler, eine undurchsichtige Vergangenheit im linken Terror der Siebziger hat, schließlich die Teilnehmer von Liannes "Erzähl mal"-Selbsthilfegruppe, die an Alzheimer im Frühstadium leiden und versuchen, das persönliche wie kollektive Schicksal narrativ zu verarbeiten.
Katastrophe ohne Katharsis.
DeLillo setzt drei Zeitschnitte, den letzten drei Jahre nach den Anschlägen, und er demonstriert so die Unmöglichkeit, die geschlagenen Wunden zu heilen. Ein bisschen fühlt man sich dabei an den Post-Vietnam-Topos erinnert, an die traumatisierten Veteranen, die nie mehr in die Normalität zurückfinden. Was etwa in Michael Ciminos Genreklassiker "The Deer Hunter" das russische Roulette, das ist hier das Pokerspiel, dem Neudecker verfällt, nachdem einige Arbeitskollegen aus seiner Pokerrunde in den Türmen ums Leben gekommen sind. Neudecker reist bald von Turnier zu Turnier, wo er, ein soziales Wrack, um höchste Einsätze zockt. Die Familie als letzter Halt war nur eine kurze Illusion; auch für eine tröstliche Katharsis taugt diese Katastrophe - anders als im Filmklischee der Siebziger - nicht.
Was DeLillo in seinem düsteren Buch vorführt, ist eine Deindividualisierung - ein Prozess, der lange vor den Anschlägen einsetzt und durch sie keineswegs an ein Ende kommt. Er läuft auf verschiedenen Ebenen ab: als Gedächtnisverlust bei den Alzheimerkranken, als Spielsucht bei Neudecker und als bewusste Auslöschung der Persönlichkeit bei einem der Attentäter, in dessen Psyche sich DeLillo ebenfalls in drei Abschnitten hineinzuversetzen sucht. Wie DeLillo die Zurichtung zum Massenmörder als Abtötung von Wünschen und Begierden, Ablenkungen und Selbstzweifeln beschreibt, ist vielleicht etwas verkürzt, aber doch überzeugend.
Dass man vor allem diese Passagen nicht an der Tiefenschärfe des Porträts des Kennedy-Attentäters Lee Harvey Oswald in "Libra"(1988) messen darf, liegt in der Natur der Sache. Während dort gerade die bis in Kindheitsmuster verfolgte Motivlage Oswalds einen plausiblen Ablauf der Ereignisse liefert und so gerade der Augenblick (jene "Sieben Sekunden" des deutschen Titels) in einen - möglichen - historischen Verlauf aufgelöst wird, ist es in "Falling Man" eben umgekehrt: Das komplexe historische und politische Geschehen wird zum vieldeutigen Einzelbild verdichtet. In der Wohnung von Liannes Mutter hängt ein Stillleben von Giorgio Morandi an der Wand, in dessen Anordnung von Kästen, Keksdosen und Flaschen Lianne plötzlich die Zwillingstürme zu erkennen glaubt.
Auch ist das Ziel der Attentäter kein konkreter Mensch, sondern das Abstraktum des gottlosen, ungläubigen Westens, dem sie selbst als reines Werkzeug einer höheren Macht entgegentreten. Auf mehreren Ebenen spielt DeLillo die Unterwerfung unter scheinbar willkürliche Regeln und Gesetze durch: die religiösen Vorschriften der Islamisten, die Geständnisrituale der Selbsthilfegruppe, der nur noch in einsilbigen Wörtern redende Justin, die in der Gruppendynamik immer rigider werdenden Pokerregeln der Männerrunde, auch die zwanghaften Wiederholungen des "Falling Man", der bewusst auf Flaschenzüge und Bungee-Seil verzichtet. Und wie jede Kunst erfordert auch das Erzählen, sich selbst im Grunde willkürliche Regeln aufzuerlegen.
Indem er den Roman mit solchen Parallelen und Analogien durchwirkt, trifft DeLillo keine extrahierbare, gar politische Aussage; es geht ihm nicht um ein Verständnis des Terrors im moralischen oder psychologischen Sinne. Derartigen Erklärungsmodellen, etwa denen des ehemaligen linken Terroristen, werden im Romanganzen eher ihre Grenzen aufgezeigt. DeLillo erzeugt vielmehr ein statisches Bild, ein Stillleben mit den Mitteln des Erzählens, in dem - wie in der lyrischen Momentaufnahme Szymborskas - die Katastrophe zugleich auf Dauer gestellt und im letzten Moment aufgehalten wird. Denn auch Neudecker hat im Turm den "Falling Man" gesehen: "Dann etwas draußen, es flog am Fenster vorbei. Etwas flog am Fenster vorbei, dann sah er es. Zuerst flog es vorbei und war weg, und dann sah er es und blieb einen Moment stehen und starrte hinaus auf nichts und hielt Rumsey weiter unter den Achseln. Er sah es immer noch, unentwegt, sieben Meter entfernt, einen Moment flog da etwas seitwärts, am Fenster vorbei, weißes Hemd, Hand erhoben, im Fall, bevor er es sah." Und später, im Treppenhaus, hat Neudecker plötzlich eine fremde Aktentasche in der Hand und trägt sie heim - auch das ein innerer Zwang, der keiner Logik folgt und gerade deswegen human ist. Der im Bild stillgestellte Moment kann noch beides, die Katastrophe wie die utopische Erlösung, enthalten. Und zwischen diesen Polen oszilliert das Erzählen des Zeitkünstlers Don DeLillo. Nur die Kunst kann die Geschichte in der Schwebe lassen.
- Don DeLillo: "Falling Man". Roman.
Aus dem Englischen übersetzt von Frank Heibert.
Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2007.
272 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Hundertprozentig gelungen findet Frank Schäfer Don DeLillos 9/11-Roman nicht, aber selbst da, wo DeLillo scheitert, kann er ihm das nicht übelnehmen. "Sperrig" nennt er den Roman, über weite Teile findet er ihn sogar "erstaunlich unspannend", auch einige allzu symbolisch aufgeladene Einfälle stören den Rezensenten und eine gewisse Handlungsarmut. Aber dagegen steht die mal bildmächtige, mal extrem karge Sprache, die DeLillo an genau den richtigen Stellen anzuwenden weiß. Oder die Montagetechnik, mit der DeLillo das Leben seines verstörten Helden mit dem Theodizee-Problem und der sich "hochschaukelnden Paranoia" verbindet. Hier zeigt sich dann DeLillo dem Rezensenten als der große Schriftsteller: Mit einer "bescheidenen Poetik", mit Gesten der "Resignation und Demut" und mit großem Können: "Die ersten und die letzten Seiten dieses Romans sind fulminant."
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Don DeLillos meisterhafter Roman macht das nationale Trauma von 9/11 fassbar, indem er es auf intime Bilder reduziert. [...] Unvergessliche Bilder von originärer Kraft.« nzz.ch