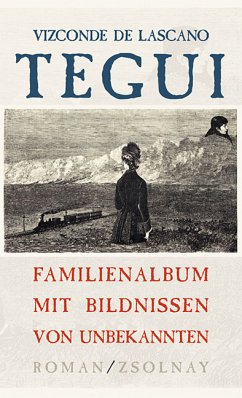Die Bildergalerie des Vizconde de Lascano Tegui
Als Walter Boehlich vor fünf Jahren bei der Friedenauer Presse seine Übersetzung des Buches "Von der Anmut im Schlafe" veröffentlichte, als dessen Autor ein gewisser Vizconde de Lascano Tegui firmierte, schien sich in den weitverzweigten Kellern der Literatur eine perfekt getarnte Geheimtür geöffnet zu haben: Nichts, buchstäblich nichts kannte man von diesem längst gestorbenen argentinischen Schriftsteller in Deutschland, weder seinen Namen (das Adelsprädikat hat er erfunden) noch seinen Werdegang oder irgendeines seiner rund zehn Bücher. Zu erkennen war an Boehlichs Übertragung allenfalls die beträchtliche literarische Qualität, eine konzentrierte Mischung aus surrealistischem Witz, Morbidität und antibourgeoiser Bosheit.
War es glaubhaft, daß der Vizconde de Lascano Tegui (1887 bis 1966), der als Bohemien vom Montparnasse mehrere Jahrzehnte in Paris gelebt hatte, durch alle Maschen des literarischen Betriebs gefallen war? Daß sich in Zeiten fieberhafter Neuentdeckungen und eifriger Umwertungen niemand seiner erinnert hatte, siebzig Jahre lang nicht? Genauso verhielt es sich, wie Dietrich Lückoffs reichhaltiges Dossier zu Lascano Tegui im "Schreibheft" (Nr. 49, Mai 1997) bewies. Neben Auszügen aus Romanen, Gedichten, Erzählungen und Selbstauskünften enthält es einen langen biobibliographischen Essay, in dem Lückhoff von der abenteuerlichen Recherche nach einem Verschwundenen berichtet.
Emilio Lascano Tegui, wie er wirklich hieß, war ein verschrobener Abweichler, den der Zufall an die Schnittstelle zwischen mehreren literarischen Bewegungen und verschiedenen Kulturen gesetzt hatte. Er schrieb, malte, verstand etwas von Zahnheilkunde, arbeitete als Journalist und Diplomat. Öffentliche Anerkennung galt ihm wenig, und jeden Nachruhm hat er selber torpediert, indem er seine Bücher als Privatdrucke in kleinster Auflage herausbrachte. Wie durch Zauber ist sein Name aus zeitgenössischen Bildlegenden verschwunden. Wer sich einen Überblick über sein Werk verschaffen will, mußte bis vor kurzem aufwendige literarhistorische Kombinatorik betreiben und sich vereinzelte Exemplare seiner Bücher in den Bibliotheken von Washington, Buenos Aires, Berlin, Brüssel, Paris und Utrecht zusammensuchen. Erst in den letzten Jahren ist in Frankreich und Argentinien das Interesse an diesem kosmopoliten Einzelgänger wieder erwacht.
Nach "Von der Anmut im Schlafe" (Paris, 1924) ist nun auf deutsch "Familienalbum mit Bildnissen von Unbekannten" erschienen, erstmals veröffentlicht 1936 in Buenos Aires. Während das frühere Werk laut Untertitel ein "Intimes Tagebuch" darstellt (der Monolog eines grundstürzend traurigen Mörders), nennt sich das spätere "Roman". Seine Rahmenhandlung darf man wohl genial nennen. Michael Bingham, Versicherungsinspektor bei "The Herold and the Star", gehört zu den Überlebenden eines Eisenbahnunglücks am 8. Juni 1900 auf der Strecke von Boulogne-sur-Mer nach Paris. Sein Arbeitgeber beauftragt ihn, einen Bericht über die Katastrophe zu schreiben und die Lebensläufe der Verstorbenen zu rekonstruieren, um aus ihnen eine Variable der menschlichen Lebenserwartung abzuleiten. Die Geschäftsidee dabei ist, die Kalkulationstabellen zu Alter, Gesundheit und Versicherungsprämie auf eine neue Grundlage zu stellen - höhere Prämien, weniger Leistung.
Aber der brave Angestellte verfängt sich rettungslos in seiner Aufgabe. Die Vergangenheit seiner zufälligen Reisegefährten ist ein schwarzes Loch, das Bingham verschluckt und erst nach einundzwanzig Jahren wieder freigibt, Jahre, "in denen er Belege zusammengetragen, Aufzeichnungen erstellt, Archive durchforstet, Karteikarten angelegt, Namen und Jahreszahlen aufgelistet hatte". Doch alles vergeblich. Als der gealterte Bingham mit einem riesigen Packen Papier vor dem Geschäftssitz seiner Versicherung steht, muß er erfahren, daß sie längst in Konkurs gegangen ist. Benommen läuft er vor dem Gebäude umher und überläßt die nutzlosen Blätter achtlos dem Wind; einige gehen verloren, die anderen sammelt der Erzähler auf und erschafft so die hübsche Herausgeberfiktion, der wir das vorliegende "Familienalbum mit Bildern von Unbekannten" verdanken.
In sechs Kapiteln, jedes davon unterteilt in etwa ein Dutzend Unterkapitel, verfolgt Bingham die Familiengeschichte von sechs getöteten englischen Fahrgästen. Er beginnt von vorn, manchmal im vierzehnten Jahrhundert. Er läßt jüdische, flämische, portugiesische oder bretonische Figuren an uns vorbeiziehen, reiht komische wie grausige Details aneinander, um schließlich bei den Eisenbahnpassagieren jenes 8. Juni 1900 anzukommen. Diese erscheinen ziemlich bieder und blutleer, nachdem man ihre pittoresken Vorfahren kennengelernt hat, etwa den Konstrukteur des ersten künstlichen Gebisses. Oder ein Genie im Serviettenfalten; einen zwergenhaften Koch zur Zeit Heinrichs VIII. mit einer Vorliebe für Farbstoff; ferner einen Räuber, der am Strick endet, den Verfasser des Werkes "Der Satz des Pythagoras, vom Mond aus betrachtet" sowie einen Mann, der glaubt, daß alle Hunde englisch sprechen.
Manchmal werden in Fußnoten körperliche Merkmale verzeichnet, und die Häufung häßlicher, rötlichblonder Männer in diesen Ahnengalerien ist durchaus auffallend. Ansonsten viel Befremdliches, Skurriles und sogar Monströses, das pointensicher und mit der allergrößten Gleichmut erzählt wird. Eine Erkenntnis geben die solcherart gesammelten Lebensläufe nicht preis - außer der einen, die Bingham am Ende selber formuliert: daß alle Genealogien falsch, daß Adel und Reinrassigkeit Phantasmen sind. Dietrich Lückoff liefert in seinem Nachwort Hinweise darauf, daß Lascano Tegui mit seinem Buch satirisch auf die multinationale Vielfalt seiner argentinischen Heimat gezielt hat. Das ist plausibel, aber es wäre zu plakativ, um darin bei einem Schreiber von solchen stilistischen Graden das Hauptmotiv zu sehen.
Ohnehin gibt es mit diesem Buch ein Problem, das sich erst enthüllt, wenn man es gelesen hat und einige Wochen später wieder in die Hand nimmt: Man kann sich an kaum etwas erinnern. Bei allem anekdotischen Reiz fehlt das notwendige Bißchen epischer Leim, um die vielen Dutzend Figuren zusammenzuhalten, was andererseits schade ist, denn jede einzelne Seite verströmt Eleganz und viel Ausgelassenheit. Da wir es es hier mit einem deutschen Text zu tun haben, steht der Anteil des Übersetzers Christian Hansen außer Frage; übrigens derselbe Christian Hansen, der neulich so wunderbar den borgesnahen, vermutlich auch lascano-tegui-nahen Roberto Bolaño übertragen hat. Weshalb man sich auch einmal den Namen eines Übersetzers merken sollte.
Darf man Lascano Tegui vorwerfen, daß er so gar nichts vom Epiker an sich hat? Nein. Trotzdem hätte sich dieser Leser manchmal einen Autor gewünscht, der nicht mit jeder Zeile glänzen will. Darin lag nun einmal Lascano Teguis Stärke, als Essayist, Ironiker, Lyriker und Feuilletonist. Sich der Mittel des bürgerlichen Romans zu bedienen war ihm ebenso fremd, wie traditionelle Poesie zu schreiben. (Er nannte sie, die Poesie, mit fast zärtlicher Herablassung "das junge Mädchen mit dem Reimklavier".) So geschieht es, daß der Vizconde im "Familienalbum" kein Gebäude, nicht einmal eine Hütte der Fiktion baut, sondern alle Ziegelsteine, die er hat, sehr sorgfältig stapelt. Als Monument mitten in der Landschaft ist diese schlanke Säule einigermaßen weit zu sehen. Doch bewohnbar ist sie nicht.
PAUL INGENDAAY
Vizconde de Lascano Tegui: "Familienalbum mit Bildnissen von Unbekannten". Roman. Aus dem Spanischen übersetzt von Christian Hansen. Mit einem Nachwort von Dietrich Lückoff. Paul Zsolnay Verlag, Wien 2000. 183 S., geb., 34,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Eine „originelle Variante der Herausgeberfiktion“ hat sich der argentinische Schriftsteller (1876 -1966) hier ausgedacht, schreibt Hanns Grössel. Den englischen Überlebenden eines Zugunglücks im Jahre 1900 in Frankreich lässt er eine „Enzyklopädie der Wahrscheinlichkeit“ im Auftrag einer Versicherung schreiben. Als diese Jahrhunderte zurückgreifende Genealogie der Verunglückten fertig ist, stellt der Schreiber, Michael Bingham fest, dass die Versicherung seit zwanzig Jahren schon nicht mehr existiert. Der von ihm verfasste Bericht wird in Teilen von einem Schriftsteller gefunden, der sie als „Familienalbum“ herausgibt. Darin erfährt man nun die Ergebnisse, d.h. die Familiengeschichte der Verunglückten, und tatsächlich gibt es nichts, was in Gestalt ihrer Vorfahren auf ein Wahrscheinlichkeit ihres Unfalltodes schließen lassen könnte; dennoch sind es vor allem deren Leben, die das Konvolut füllen, während die Verunglückten nur noch als „nachgetragene Schlussfloskeln“ wirken. Hanns Grössel fügt seiner Besprechung einige bio-bibliografische Daten zu Tegui hinzu und gibt als Quelle die Zeitschrift „Schreibheft“ Nr.49 von 1997 an, in der erste Auszüge aus diesem Roman erstmals auf Deutsch erschienen waren.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Absolute Höhepunkte gelehrsam-skurriler Fabulierkunst - irgendwo zwischen Jorge Luis Borges, Raymond Roussel und dem späten Georges Perec." Klaus Taschwer, Falter, 10.03.00
"Trotz einer melancholischen Note ist 'Familienalbum' ein ungemein witziges Buch. Das liegt daran, dass Tegui nicht nur die Gesetze der Genetik ad absurdum führt, sondern sich auch in freiem Flug über die Grenzen von Glaubwürdigkeit und Wahrscheinlichkeit hinwegsetzt. Er spießt das aus dem Rahmen der Logik Fallende auf: das Unglaubliche, Unerhörte, Bizarre, Makabre. [...] Tegui zeigt das Menschengeschlecht als Narrenhaus, als zirkusreifes Panoptikum, als erheiternden Zoo menschlicher Unzulänglichkeiten." Birgit Veit, Berliner Zeitung, 18.03.00
"Das "Familienalbum mit Bildnissen von Unbekannten" strotzt von phantastischen Einfällen." Andreas Breitenstein, Neue Zürcher Zeitung, 06.05.00"Verpackt in treffsichere Witze und absurde Situationskomik, kommt diese kleine Geschichte des allgemeinen Unsinns recht elegant daher. (...) Es ist eine Sammlung von witzigen, pointiert aufgebauten Szenen aus dem Alltagsleben, von Geschichten über Sonderlinge und historischen Anekdoten. Oder pseudohistorischen, da der schwarze Humor des Autors nicht nur die Möglichkeit von Rassen- und Herkunftsreinheit in Frage stellt, sondern geschichtlicher Wahrheit überhaupt. Der Reigen, den die Menschheit hier bis zum leichten Schwindel tanzt, ist von einem klugen, ironischen, etwas eitlen und zutiefst pessimistischem Künstler skizziert. Die klar strukturierten und üppig ausgeschmückten Geschichten sind eine angenehme Lektüre voller Überraschungen, angesichts derer man mal eine Gänsehaut bekommt, mal glücklich lächelt." Olga Martynova, DerTagesspiegel, 16.04.2000
"Er erzählt eine rätselhafte, raffiniert konstruierte Geschichte, die unterstreicht, welch ungewöhnlicher Autor hier dem Vergessen entrissen wird."
Norbert Wehr, Frankfurter Rundschau, 15.04.2000
"Trotz einer melancholischen Note ist 'Familienalbum' ein ungemein witziges Buch. Das liegt daran, dass Tegui nicht nur die Gesetze der Genetik ad absurdum führt, sondern sich auch in freiem Flug über die Grenzen von Glaubwürdigkeit und Wahrscheinlichkeit hinwegsetzt. Er spießt das aus dem Rahmen der Logik Fallende auf: das Unglaubliche, Unerhörte, Bizarre, Makabre. [...] Tegui zeigt das Menschengeschlecht als Narrenhaus, als zirkusreifes Panoptikum, als erheiternden Zoo menschlicher Unzulänglichkeiten." Birgit Veit, Berliner Zeitung, 18.03.00
"Das "Familienalbum mit Bildnissen von Unbekannten" strotzt von phantastischen Einfällen." Andreas Breitenstein, Neue Zürcher Zeitung, 06.05.00"Verpackt in treffsichere Witze und absurde Situationskomik, kommt diese kleine Geschichte des allgemeinen Unsinns recht elegant daher. (...) Es ist eine Sammlung von witzigen, pointiert aufgebauten Szenen aus dem Alltagsleben, von Geschichten über Sonderlinge und historischen Anekdoten. Oder pseudohistorischen, da der schwarze Humor des Autors nicht nur die Möglichkeit von Rassen- und Herkunftsreinheit in Frage stellt, sondern geschichtlicher Wahrheit überhaupt. Der Reigen, den die Menschheit hier bis zum leichten Schwindel tanzt, ist von einem klugen, ironischen, etwas eitlen und zutiefst pessimistischem Künstler skizziert. Die klar strukturierten und üppig ausgeschmückten Geschichten sind eine angenehme Lektüre voller Überraschungen, angesichts derer man mal eine Gänsehaut bekommt, mal glücklich lächelt." Olga Martynova, DerTagesspiegel, 16.04.2000
"Er erzählt eine rätselhafte, raffiniert konstruierte Geschichte, die unterstreicht, welch ungewöhnlicher Autor hier dem Vergessen entrissen wird."
Norbert Wehr, Frankfurter Rundschau, 15.04.2000