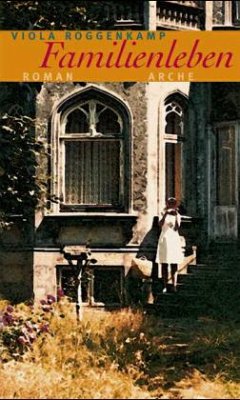Eine jüdisch-deutsche Familie 1967 in Hamburg. Ein sensibel-sinnliches Zeitbild, zugleich ein berührender Entwicklungsroman über die dreizehnjährige Ich-Erzählerin.
Sensibel erzählt die renommierte Publizistin Viola Roggenkamp die fiktive Geschichte einer jüdisch-deutschen Familie 1967 - ein berührender Entwicklungsroman über die 13-jährige Ich-Erzählerin Fania Schiefer.
Fania findet sich weder in ihrer deutschen Muttersprache noch in der deutschen Vaterstadt zurecht. Während der Vater, mit dessen Hilfe Mutter Alma und Großmutter Hedwig die Nazizeit überlebten, unter der Woche als Vertreter unterwegs ist, wacht Alma über die Familie, in der übergroße Nähe und der Wunsch nach Trennung vereint sind. Das Beziehungsgeflecht gerät durcheinander, als in Israel 1967 der Sechs-Tage-Krieg ausbricht und die Nachrichten über den Schah-Besuch sowie die ersten Berliner Studentendemos in die scheinbare Familienidylle platzen.
Sensibel erzählt die renommierte Publizistin Viola Roggenkamp die fiktive Geschichte einer jüdisch-deutschen Familie 1967 - ein berührender Entwicklungsroman über die 13-jährige Ich-Erzählerin Fania Schiefer.
Fania findet sich weder in ihrer deutschen Muttersprache noch in der deutschen Vaterstadt zurecht. Während der Vater, mit dessen Hilfe Mutter Alma und Großmutter Hedwig die Nazizeit überlebten, unter der Woche als Vertreter unterwegs ist, wacht Alma über die Familie, in der übergroße Nähe und der Wunsch nach Trennung vereint sind. Das Beziehungsgeflecht gerät durcheinander, als in Israel 1967 der Sechs-Tage-Krieg ausbricht und die Nachrichten über den Schah-Besuch sowie die ersten Berliner Studentendemos in die scheinbare Familienidylle platzen.

Bilder im Ohr: Viola Roggenkamps Debütroman
Viel vorgelesen zu bekommen gilt als entwicklungsfördernd. Ein herrlicher Zeitvertreib ist es außerdem. Was aber, wenn ein Kind lieber immer weiter zuhört, statt selbst mit dem Lesen anzufangen? Was, wenn es geradezu süchtig ist nach den Geschichten, die ihr die ältere Schwester abends vorliest?
Vera und Fania schlafen in einem Bett, auf der alten Schlafcouch der Eltern; Vera auf der Seite der Mutter, Fania auf der des Vaters. Fania liebt den Tag und seine hellwachen Ereignisse, ihre Schwester die Nacht mit ihren Träumen. Vera behauptet, sich an jeden Traum erinnern zu können: Damit und mit Spekulationen über "Bobbi", den fabelhaft schicken Deutschlehrer Wilhelm Bobbenberg, verbringt sie die Tage. Für Fania dagegen ist Lehrer Bobbi ein sehr reales Schreckgespenst. Denn Fania kann nicht richtig schreiben, oder vielmehr: Sie schreibt, doch ihre Wörter sind krumm und schief, ihre Aufsätze stets voll von roter Korrekturtinte. "Sprechen" etwa buchstabiert sie "schbrächn", und schon wollen Lehrer und Mitschüler sich ausschütten vor Lachen. Vera dagegen ist in Deutsch Klassenbeste; zu Hause sitzt sie und liest und ißt dabei und findet sich anschließend zu dick. Vera ist siebzehn und "in der Entwicklung". Fania ist dreizehn und wartet sehnsüchtig darauf, auch einen Busen und ihre Tage zu bekommen.
Es sind zahlreiche Werke über die Schoa geschrieben worden; genug wird es niemals geben können. Bücher über deutsch-jüdisches Leben nach 1945 dagegen gibt es nur sehr wenige, während etwa im angelsächsischen oder osteuropäischen Raum auch moderne jüdische Biographien häufig dargestellt wurden. Nun schildert die Journalistin Viola Roggenkamp in ihrem ersten Roman den Alltag einer deutsch-jüdischen Familie Mitte der sechziger Jahre in einer lädierten Villa in Hamburg-Harvestehude, und sie tut dies auf so behutsame, souveräne und eindringliche Weise, daß man "Familienleben" schon nach wenigen Seiten nicht mehr aus der Hand legen möchte.
Nicht das Spektakuläre, das Außergewöhnliche oder Aufsehenerregende ist Thema dieses Romans, sondern das ganz normale, tägliche Leben, erzählt von der temperamentvollen dreizehnjährigen Fania. Ihre Perspektive geht nicht nach außen, sondern nach innen, denn auch Viola Roggenkamp schreibt aus der Mitte, nicht als Beobachterin vom Rand: Darin liegt die Stärke ihres Buchs. Fania schildert uns den Familienalltag wie eine beschwingte Theateraufführung, wo jeder seinen Platz und seine Rolle hat; sie selbst ist Teil davon, fühlt sich aber zugleich isoliert. Denn noch gehört sie nicht zu den Frauen, deren Beschäftigung mit Pumps, Nagellack und Lippenstift sie mit unbeteiligter Neugier beobachtet, und erst recht nicht zu den Erwachsenen, die Zigaretten rauchen, häufig über Geld reden und merkwürdige geschlechtliche Bedürfnisse haben. Vera steht ihr am nächsten, doch je mehr sich die Schwester zu einer jungen Frau mit eigenen Geheimnissen entwickelt, desto fremder erscheint sie Fania.
Als berückende Besucherin von einem fremden Stern erscheint bisweilen auch die Mutter, das quirlige, aufregend weibliche Zentrum der Wohngemeinschaft, die aus den Eltern Alma und Paul Schiefer, ihren Töchtern Vera und Fania sowie der Großmama Hedwig Glitzer besteht, Almas Mutter. Alma umzingelt ihre Schäfchen mit Liebesbeweisen; da wird immerzu geküßt und umarmt, gelacht und geweint, gesorgt und gezweifelt, jede Emotion geteilt. Doch was zunächst wie beneidenswerter Gefühlsüberschwang anmutet, ist in Wahrheit ein feinstgesponnener Kokon, der die Familienmitglieder vor der Außenwelt beschützen soll, die Töchter aber zusehends einengt. Je mehr aber Fania von der Geschichte Almas und ihrer Mutter, von den Gefahren, Entbehrungen und dem Leid des Kriegs preisgibt, von der Ablehnung der jüdischen Schwiegertochter durch Pauls Eltern, desto deutlicher wird, daß die Kußrituale einfach Almas Art sind, sich ihrer Familie zu vergewissern: eine Überlebensstrategie. Religiöse Bräuche, Gebete gar spielen für sie keine große Rolle; Pakete, die zum Pessach-Fest aus Israel eintreffen, sollen die Nachbarn allerdings lieber nicht sehen, findet Alma. Und besteht darauf, Weihnachten mitzufeiern, mit Tannenbaum und Gans, weil es so ein "schönes Fest" ist.
Die Spannungen erwachsen ebenso aus dem Umfeld der Schiefers wie aus der Familie selbst. Alma reibt sich an der Omnipräsenz ihrer Mutter; Vera lehnt sich immer mehr gegen die schöne, dominante Alma auf; Fania wiederum ist unglücklich, weil Vera unwiederbringlich von ihr weg in die Welt der Großen driftet. Alma ist besessen von dem Wunsch, das Haus zu kaufen, in dem sie wohnen, doch es fehlt an Geld. Und als Vera ausgerechnet mit dem Nachbarn Hainichen schäkert, wiegt für Alma weitaus schwerer, daß dieser Nazi war, als daß er verheiratet ist.
Durch die Großmutter und ihre Freundinnen, das "Theresienstädter Kränzchen", lernt Fania jüdische Riten und jiddische Ausdrücke kennen; von der Mutter hört sie, welches Entsetzen das Judentum über Familienmitglieder, Freunde, Verwandte und Bekannte gebracht hat. Und sie versteht, welch verstörende Kraft allein von bestimmten Worten ausgeht: "Juden. Es ist ein gutes Wort, ich mag es, Juden, und bei uns im Haus und im Garten darf es sich frei bewegen. Wie es aber aus dem Mund dieser Frau kommt, starren wir darauf, und Harald Schiefer sagt zu seiner Frau, nein Gudrun, so ist das ja nun nicht, was gewesen ist, ist gewesen." Auch, daß das Gewesene keineswegs vergangen ist, begreift Fania, die sich zu jedem Wort ein Bild vorstellt, auf ihre Weise: " . . . und auf einmal war da Frau Hainichen, und ich bin in sie hineingerannt. Sie wird denken, ich bin meschugge, meschugge denkt sie nicht, sie denkt verrückt." Sie selbst ist einigermaßen entschieden, was ihre Identität angeht: "Müßte ich wählen, würde ich immer ihre Seite wählen, jüdisch zu sein ist besser, als nicht jüdisch zu sein, besonders wenn man deutsch ist, und das sind wir außerdem." Vera bringt es auf den Punkt: "Kennst du das Gefühl, die anderen wissen gar nicht, daß es uns gibt. Sie gehen davon aus, daß es uns gar nicht mehr geben kann. Und wenn sie von uns hören, haben sie es im nächsten Moment wieder in sich ausgelöscht. Wir brauchen uns damit gar nicht vor ihnen zu verstecken, wie Mami es immer von uns verlangt. Wir könnten so oft sagen, wie wir wollten, daß wir jüdisch sind. Es hört uns niemand."
Während eine hervorragende Ausstellung im Frankfurter Haus Gallus derzeit - unter Polizeischutz - an den Auschwitz-Prozeß vor vierzig Jahren erinnert, erscheint Viola Roggenkamps Roman fast wie eine Ergänzung zur rechten Zeit, just als die Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen in formelhafter Rhetorik und wohlfeilen Gesten zu ersticken droht. Denn auf der Suche nach den eigenen Wurzeln wird Fania unversehens zur Chronistin mehrerer Generationen: "Ein Berg von Geschichten. Ich trage die Schichten ab. Meine Mutter ist eine Geschichtenerzählerin, sie malt mir Bilder ins Ohr. Ich halte mein Herz an, um ihres schlagen zu hören, ich taste mich lautlos durch ihr heimliches Leben."
Diese tastende Bewegung ist es, die den Roman über viele kleine und größere Ereignisse hinweg zusammenhält. Viola Roggenkamp hat einen langen Atem. Ihre Fania erzählt wie jemand, der einmal tief Luft holt und dann loslegt, ohne Punkt und Komma zu einer Suada ansetzt, die nichts Klagendes hat, aber vieles berichtet, was den Leser nachdenklich zurückläßt. Nicht zuletzt ist "Familienleben" dabei ein zeitgemäßes Monument des jüdischen Erzählstils. Das Blumige, Ausufernde des Jiddischen, dieser jahrhundertealten Sprache, die auf ihrer Wanderschaft durch das Hebräische, Slawische, Aramäische, Altfranzösische und Altitalienische und natürlich das Deutsche immer beschreibungssüchtiger und wortmächtiger wurde, blitzt hier in manch berückender Passage auf. Und wie eine Verneigung vor dem jiddischen Witz wirkt der feinsinnige Humor, mit dem Viola Roggenkamp ihre Figuren schildert. Indem sie jene Erzähltradition aufgreift, die ihre Kraft aus dem fortwährenden Weitergeben von Erinnerung bezieht, schafft sie einen eigenen, atmosphärisch dichten Kosmos.
Dennoch soll nicht verschwiegen werden, daß dieser schöne, sinnliche und einnehmende Roman auch Schwachstellen hat, zumal gen Ende. Auf den letzten fünfzig Seiten verläßt die Autorin ihr bis dahin sicheres Gespür für Takt und Tempo. Zum Schluß läßt sie Fania ihre Sexualität entdecken. Daß dies mit der Mutter einer Schulfreundin geschieht, die ihr gerade die schwüleren Stellen aus den "Wahlverwandtschaften" vorliest, ist noch nicht das Schlimmste. Wenn die glaubwürdige, natürliche Erzählerin Fania zum Schluß völlig konstruiert wirkt, liegt das an Viola Roggenkamps hemmunglosem Gebrauch von Klischees - und an Sätzen wie diesen: "Sie ist keine Jüdin, die Jüdin bin ich, das weiß sie nicht. Ich will sie verführen, ich bin die Jüdin, die verführt, ich will sie küssen."
Die Goethe-Lektion hat Folgen. Nachts liest Fania heimlich unter der Bettdecke die "Wahlverwandtschaften" zuende und kann mit dem nächsten Aufsatz erstmals vor dem gefürchteten Deutschlehrer bestehen. Mit der ersten eigenen Lektüre beginnt ihr Abschied von der Kindheit.
Viola Roggenkamp: "Familienleben". Roman. Arche Verlag, Zürich/Hamburg 2004. 437 S., geb., 23,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Viola Roggenkamps Romanerstling beschreibt das, worüber es nur wenige Bücher gibt, so die Rezensentin Felicitas von Lovenberg, nämlich "das deutsch-jüdische Leben nach 1945", in einer Hamburger Familie der Sechziger Jahre. Und wie Roggenkamp diese mehrere Generationen umspannende Familie aus der Perspektive der dreizehnjährigen Fania einfängt, findet die Rezensentin so eindringlich wie spannend erzählt. Denn es stelle sich zunehmend heraus, dass der geschlossene Familienkreis, in dem man sich ständig gegenseitige Zuneigung versichert, in Wirklichkeit auf einer wohlgesponnenen "Überlebensstrategie" basiert. Sehr interessant findet die Rezensentin die besondere Art der Spannungen, die sich bei Roggenkamp entwickeln. Denn aus der Außenwelt, die das Wort "Jude" kaum registriert, verlagere sich die Identitäts- und Geschichtsfrage in den Kreis der Familie, und naturgemäß besonders in die Innenwelt der heranwachsenden Fania. Für Lovenberg ist Roggenkamps Roman ein "zeitgemäßes Monument des jüdischen Erzählstils". Allein das Ende - als Fania ihre Sexualität entdeckt - weist einige Klischees auf, so die einzige Kritik der ansonsten sehr eingenommenen Rezensentin.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH