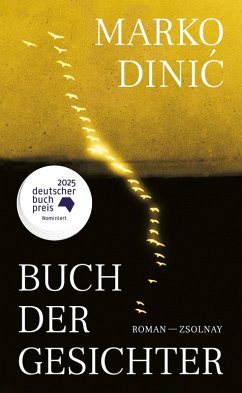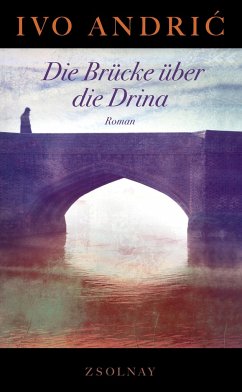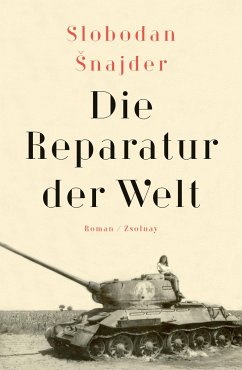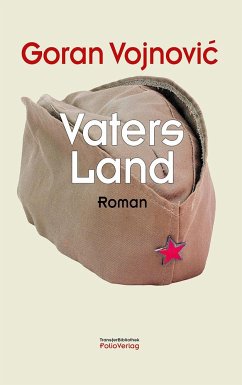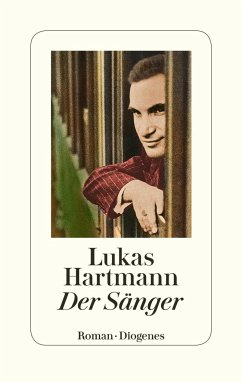Familienzirkus
Die großen Romane und Erzählungen
Mitarbeit: Rakusa, Ilma;Herausgegeben: Rakusa, Ilma
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
34,90 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
In seiner Heimat Jugoslawien zunächst heftig bekämpft, wurde Danilo Kis bald als einer der größten Erzähler der europäischen Nachkriegsliteratur anerkannt. Mit seinem einzigartigen literarischen Werk schrieb er gegen das Vergessen und den Tod an. In seiner Trilogie "Frühe Leiden", "Garten, Asche", "Sanduhr", die er selbst auch "Familienzirkus" nannte, hat er dem in Auschwitz ermordeten Vater und der Kultur Mitteleuropas ein Denkmal gesetzt. Seine "Enzyklopädie der Toten", die jetzt endlich in einer Neuübersetzung vorliegt, ist sein bekanntestes Buch geworden. Zu seinem 25. Todestag er...
In seiner Heimat Jugoslawien zunächst heftig bekämpft, wurde Danilo Kis bald als einer der größten Erzähler der europäischen Nachkriegsliteratur anerkannt. Mit seinem einzigartigen literarischen Werk schrieb er gegen das Vergessen und den Tod an. In seiner Trilogie "Frühe Leiden", "Garten, Asche", "Sanduhr", die er selbst auch "Familienzirkus" nannte, hat er dem in Auschwitz ermordeten Vater und der Kultur Mitteleuropas ein Denkmal gesetzt. Seine "Enzyklopädie der Toten", die jetzt endlich in einer Neuübersetzung vorliegt, ist sein bekanntestes Buch geworden. Zu seinem 25. Todestag erscheinen seine wichtigsten Werke in einem Band - eine Einladung, diesen Autor immer wieder und immer neu zu lesen.