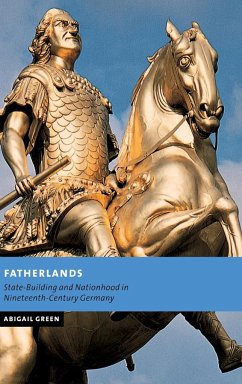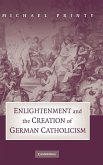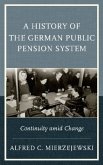Fatherlands is an original study of the nature of identity in nineteenth-century Germany, which has crucial implications for the understanding of nationalism, German unification and the German nation state in the modern era. The book approaches these questions from a new and important angle, that of the non-national territorial state. It explores the nature and impact of state-building in non-Prussian Germany. The issues covered range from railway construction and German industrialisation, to the modernisation of German monarchy, the emergence of a free press, the development of a modern educational system, and the role of monuments, museums and public festivities. Fatherlands draws principally on extensive primary research focusing on the three kingdoms of Hanover, Saxony and Württemberg. It is an attempt to 'join up the dots' of German history - moving beyond isolated local, regional and state-based studies to a general understanding of the state formation process in Germany.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Sie suchten auch keine zukünftige, wie Abigail Green belegen kann: Vor der Reichsgründung wuchs vielmehr die Bedeutung der Einzelstaaten
Er sei ein Deutscher? fuhr der Alte den Sohn an. Er stamme doch aus Meißen, mithin sei er Sachse. "Mein Vaterland, dem Sachsen angehört, ist Deutschland", beharrte der Junior. Der fiktive Streit in Kleists "Katechismus der Deutschen" von 1809 illustriert den Übergang vom traditionellen Landespatriotismus zum modernen Nationalbewußtsein. Abigail Green stellt den Disput an den Beginn ihrer Dissertation, in der sie es freilich etwas genauer wissen will. Sie untersucht, inwieweit die deutschen Einzelstaaten im Strudel der Nationsbildung des neunzehnten Jahrhunderts ihren Bürgern noch einen partikularen Identifikationsraum bieten konnten und wollten.
Sie wählt drei etwa gleich große Mittelstaaten, die Königreiche Hannover, Sachsen und Württemberg, und prüft dort alle Politik- und Kulturfelder auf ihre identitätsstiftende Kraft. Anders als Preußen und besser als Bayern stünden diese Länder für das "Dritte Deutschland" der Klein- und Mittelstaaten. Zugleich offerieren sie der Forscherin mit dem Industrieland Sachsen, dem agrarisch geprägten Hannover und dem kleingewerblich dominierten Württemberg eine gewisse ökonomische Bandbreite. Der zeitliche Schwerpunkt ist mit den 1850er und 1860er Jahren forschungsstrategisch glücklich abgesteckt, handelt es sich doch um die unmittelbare Vorphase der Nationalstaatsgründung und zudem um eine Epoche, die noch immer schwächer erforscht ist als die Dezennien zuvor und danach.
Die Regierungen zogen alle Register, wenn es darum ging, den Staat im Bewußtsein der Bürger einzuwurzeln: in der Kultur- und Bildungspolitik, durch Medienbeeinflussung und Propaganda, ja selbst durch den Eisenbahnbau. Unter anderem galt es, die Dynastie und insbesondere den regierenden Monarchen populär zu machen. Der württembergische König Wilhelm I. etwa ritt während des Feierzugs zu seinem silbernen Thronjubiläum 1841 spontan auf einen gebrechlichen und hochbetagten Teilnehmer zu und verbeugte sich vor ihm. Parallel zu solcher Vermenschlichung des Monarchen beobachtet Green eine fortschreitende Mythologisierung, die Etablierung einer königlichen Aura, die sich von der Person gelöst habe. Sie präsentiert dies als neuen Faktor der Epoche, freilich erinnert er doch sehr an die zwei Körper des Königs, die Ernst Kantorowicz für die Zeit des Mittelalters diagnostiziert hat.
Nationalgeschichte überrumpelte
Zwar ließen sich die Deutschen seit dem Krieg gegen Napoleon von nationaler Geschichte faszinieren und überrumpeln, gaben sich einem Arminius-Rausch hin und suchten die Wurzeln deutscher Einheit in germanischer Vorzeit. Doch "ironischerweise", wie Green schreibt, konzentrierte sich in der Folge das breite Interesse auf die partikularen Landesgeschichten, denn die zahlreichen historischen Vereine organisierten sich auf regionaler Basis. Die meisten dieser Unternehmungen blieben unter staatlichem Einfluß und von staatlichen Mitteln abhängig.
Es war dieselbe Zeit, in der ein regelrechter Museen- und Denkmälerkult um sich griff. Zwar waren Herrscherdenkmäler nichts Neues. Neu war aber der Umgang mit ihnen. Das zeigt eine Episode um das Standbild des Goldenen Reiters, das in der Dresdner Neustadt August den Starken darstellt. Die Statue war so vergammelt, daß 1864 das Schwert herunterfiel. Ein Passant griff es auf und übergab es den Militärbehörden. Das Spannende an der Geschichte aber ist, was dann passierte - nämlich nichts. Zum selben Zeitpunkt, da Deutschland und Sachsen mit einem Netz von Herrscherdenkmälern überzogen wurde, ließ man sich mit der Restaurierung des Goldenen Reiters fast zwanzig Jahre Zeit. Die Statue, so Greens Erklärung, erfüllte nicht die aktuell gewünschte Funktion. Denn Denkmäler waren nicht an sich wichtig, wichtig war ihre Verknüpfung mit der Öffentlichkeit. Die Initiative sollte von unten nach oben gehen, die Denkmäler vom Volk gestiftet, die Gelder von Bürgerinitiativen gesammelt werden.
Diese Sichtweise war riskant. Denn nicht immer erbrachten die Sammlungen genügend Mittel, wodurch der Eindruck eines negativen Plebiszits entstehen konnte. Mit allerlei Tricks versuchte man, eine solche Abstimmung mit dem Geldbeutel zu verhindern. Neben die weicheren Formen der politischen Klimapflege traten Versuche, die Öffentlichkeit direkt über die Zeitungen zu beeinflussen. In Württemberg bemühte sich der König, den "Staats-Anzeiger" in ein Hardliner-Organ umzuschmieden, während die Ministerriege einen diplomatischeren Ton wünschte. Wilhelms Büro traktierte die Redaktionsleitung mit Artikeln, die meist abgelehnt wurden - ein schönes Beispiel nebenbei für den monarchischen Muskelschwund im neunzehnten Jahrhundert.
Den lebendigsten Abschnitt widmet Abigail Green mit Zollverein und Eisenbahnpolitik jenen Faktoren, die gemeinhin als Katalysatoren der nationalen Verschmelzung gelten. Doch Green variiert dieses klassische Thema der Geschichtsschreibung. Der Zollverein habe zwar Vereinigung befördert, zugleich aber die einzelstaatlichen Systeme seiner Mitglieder stabilisiert, weil die hohen Zolleinnahmen die Regierung vom Parlament unabhängiger gemacht haben. Und die Möglichkeit, sich mit Eisenbahnpolitik zu profilieren und zu legitimieren, haben die meisten deutschen Regierungen - teilweise zögerlich - gierig ergriffen. Ursprünglich hatte der hannoversche König noch geäußert, er wolle keine Eisenbahnen, da sonst "jeder Schuster und Schneider so rasch reisen kann wie ich".
Netze innerhalb der Grenzen
Es entstand kein nationales Netz, sondern ein Konglomerat, das nach den Interessen der Einzelstaaten gesponnen wurde. Jeder Staat suchte sein Netz um die eigene Hauptstadt zu zentrieren. In Württemberg und Baden wählte man absurde Streckenführungen, um nicht das Nachbarland oder das preußische Hohenzollern berühren zu müssen. Aus Sicht der Staaten war dieser Eisenbahnpartikularismus aber rational, wie Green ausführt. Die Netze brachten den Landbewohnern die Hauptstadt nahe und eröffneten den Hauptstädtern die Möglichkeit, die Provinz kennenzulernen. So wuchs Landesbewußtsein.
Green nutzt das in den vergangenen zwei Jahrzehnten erstellte Theorieinstrumentarium, das die Nation als Ergebnis von Denkleistung und Phantasie begreift. Sie wendet es nun auf die Einzelstaaten an und zeigt, wie sich diese Kunstgebilde eine ethnische Basis in Form von Stämmen bastelten, wie sich Hannover als Heimat der Niedersachsen gerierte, Sachsen als die der (Ober-) Sachsen und Württemberg als Stätte der Schwaben. Der antipreußische Affekt, der in allen drei Staaten das Eigenbewußtsein formte, ließ sich nach der Nationalstaatsgründung nicht mehr so effizient einsetzen. Doch noch in den bayerischen und württembergischen Volksschulbüchern des Kaiserreichs entdeckt Green eine alternative Erzählung der Reichsgründung, in der Bismarck fast keine, die Truppen des jeweiligen Landes dagegen eine große Rolle bei der Herstellung der deutschen Einheit spielten. Im Ergebnis hat diese Politik zu einer Art Deutschland der Vaterländer geführt, zu einer Nation, deren Angehörige eine zweite Identität besitzen.
Das ist nun so neu nicht. Bislang aber dürfte die Mehrheit der Historiker der These zugeneigt sein, daß mit zunehmender Bedeutung der Nation die einzelstaatliche Identität sich abgeschwächt habe. Während der Blick sich mehr und mehr auf die Nation richtete, so dagegen Greens These, konnte in Deutschland das einzelstaatliche state building Erfolge verbuchen. Oder, um das Kleistsche Bild von Vater und Sohn zu variieren: Ein fiktiver Enkel hätte deutscher als der Sohn und zugleich sächsischer als der Vater empfunden.
RALF ZERBACK
Abigail Green: "Fatherlands". State Building and Nationhood in Nineteenth Century Germany. Cambridge University Press, Cambridge 2001. 398 S., Abb., geb., 45,- Britische Pfund.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
'... it will be a great success which will make many stimulating contributions to early modern and modern European history ... elegant, persuasive, and eminently readable ... Abigail Green has succeeded in moving the goal posts for any enquiry into the growth of nationalism and the persistence of particularism in Germany in the second half of the nineteenth century.' Bulletin of the German Historical Institute, London