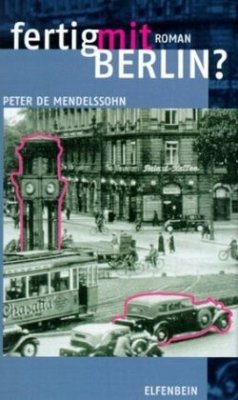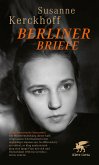"Denk an mich, wenn du zwischen Telephon und Telegraph den Atem der großen Stadt hörst." Das sind die letzten Worte des einflussreichen Schwiegervaters, als er Oswald, der gerade in einem oberbayerischen Internat sein Abitur abgelegt hat, in der Feuilletonredaktion einer großen Berliner Zeitung abliefert. Bald hat Oswald den unsicheren Einstand des Adoleszenten hinter sich gelassen und im geschäftigen Leben des Berlin der zwanziger Jahre Tritt gefasst. Angezogen und abgestoßen von lebenslustigen, ehrgeizigen Frauen und in ständiger Konkurrenz zu seinem begabten Dichterfreund Manfred, mit dem ihn eine innige Hassliebe verbindet, verschwendet er Zeit und Geld im Milieu der Künstler und Journalisten, die im "Romanischen Café" und bei "Schwanneke" verkehren, und gerät in den Sog der Großstadt, der ihn unaufhaltsam aus der Bahn zu werfen droht.Peter de Mendelssohns Roman ist nicht nur Barometer, sondern gleichzeitig ein Mitgestalter des Lebensgefühls seiner Generation, die Flair und Hektik der Großstadt als Lebensumfeld zu bejahen beginnt.In der Aufbruchstimmung der Jugend mit ihrem Lebenshunger und dem unbeirrbaren Willen, die eigene Kreativität zum Erfolg zu machen, findet sich neben Zeitkolorit auch so manche Parallele zu unserer Zeit: Dabei sein muss man, immer in Bewegung. "In Berlin kann man aushalten oder ausreißen. Nur eines nicht: untätig sein."
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Frühe Popliteratur: Peter de Mendelssohns "Fertig mit Berlin?" · Von Jörg Magenau
Auf einer Abendgesellschaft in der bayrischen Provinz wird über Berlin als geistiges Zentrum des neuen Deutschlands diskutiert. Man ist sich einig, daß die Metropole schlechte Einflüsse auf einen noch jungen, ungefestigten Geist ausübe. "Ich würde meinen Sohn nie nach Berlin schicken", sagt ein älterer Herr, der die Hauptstadt für einen "Wasserkopf", ein "unnatürliches Gebilde" hält, in dem der junge Mensch nur auf Abwege geraten könne. "In Berlin", sagt er, "muß man bereits etwas sein, um in den Cliquen leben, mit der geistigen Korruption schwimmen zu können. In Berlin kann man nichts werden." Wir schreiben das Jahr 1927. Erstaunlich, daß Sätze wie dieser 75 Jahre unverändert überdauern konnten.
Der Neuankömmling mit dem frisch erworbenen Abitur hätte sich Berlin etwas großartiger vorgestellt. Sein Stiefvater hat ihm eine Stelle in der Feuilletonredaktion einer großen Zeitung verschafft. Nun ist er gekommen, sein neues Leben zu beginnen. Die Stadt erscheint ihm kalt und leblos. Der Frühling läßt hier auf sich warten. Frierende Schuhputzer hocken auf ihren Bänkchen. Die Straßen sehen einander zum Verwechseln ähnlich, so daß man sich leicht verläuft. Die Augsburger Straße war damals schon so häßlich wie heute, besonders dann, wenn der Nieselregen die Konturen verwischt. Berlin ist eine Weltgegend, die man sich erarbeiten muß. Es ist keine Stadt, die dem Besucher zu Füßen liegt. "In Berlin kann man aushalten oder ausreißen. Nur eines kann man nicht: untätig sein", lautet das Resümee in Peter de Mendelssohns Debütroman aus dem Jahr 1930, den der Elfenbein-Verlag nun neu herausgebracht hat. "Fertig mit Berlin?" heißt das Werk mit einem Fragezeichen, das den Vorsatz, mit dieser Stadt jemals abschließen zu können, in berechtigte Zweifel zieht. Berlin macht dich fertig, das ist die Botschaft, und du kommst nie wieder davon los.
Mendelssohn war mehr Journalist als Schriftsteller, obwohl er, wie Katharina Rutschky im Nachwort erwähnt, bis 1945 neun belletristische Werke verfaßte. Auch seinem Debüt ist anzumerken, daß es schnell geschrieben ist. Mendelssohn war befreundet mit Klaus Mann, in zweiter Ehe verheiratet mit Hilde Spiel, mit der er vor den Nazis ins Exil floh. Bekannt wurde er nach 1945 als Herausgeber der Tagebücher Thomas Manns, als Mitbegründer des "Tagesspiegels" und der "Welt" und als Autor eines Standardwerkes über die "Zeitungsstadt Berlin".
Peter de Mendelssohns Berlin wirkt merkwürdig vertraut. Die Verhaltensmuster sind dieselben wie heute, nur die Szenerien haben sich ein wenig verändert. Statt im angesagtesten Szenelokal in Mitte saß man einst im romanischen Café oder bei Schwanneke in der Rankestraße, Berlin W 50. Hier war die Börse für Kunst, Theater, Literatur und verwandte Betriebe. Geld, nun ja. Irgend jemand würde einem schon noch etwas pumpen. Die Schulden steigen, die Liebesabenteuer werden immer verzwickter, der Job droht verloren zu gehen, und so geht es immer weiter. Konkurrenz, Leistungsdruck, Einsamkeit. "Wer in Berlin am meisten Leute kennt, der ist obenauf", lautet eine Maxime des sozialen Überlebenskampfes im Kulturbetrieb. Und für die Liebe gilt: "Natürlich ist es Unfug zu glauben, daß irgendwelche Menschen zusammengehören. Alle fünf Minuten gruppiert sich irgendetwas um."
Auch der Autor selbst, der gerade mal 22 Jahre alt war, als dieses Buch erschien, könnte eine Figur von heute sein. Jugendlichkeit, Authentizität, übersteigerte Egomanie, das Pathos der neuen Sachlichkeit und Erlebnishunger waren Markenzeichen der Generation, die ins Leben drängte, ohne zu wissen, wo es zu finden sei. Das Schlagwort "Pop" war damals noch nicht erfunden, doch der Zwang zu Selbstinszenierung und rastloser Produktivität nicht geringer. Die Rotationsmaschinen der Druckindustrie waren unersättlich. Das Bemühen, nicht in Vergessenheit zu geraten, steigerte den literarischen Output. Schnell mußte alles gehen, das Schreiben und das Lesen und das Leben. Dagegen leben wir heute gemächlich.
Wenig ist in diesem Roman von Politik und Zeitgeschichte zu erfahren. Der jugendliche Held interessiert sich nicht für diese Dinge und hat genug mit sich selbst zu tun. Er redigiert die Spalten des Feuilletons, wie es ihm aufgetragen wird, und bringt die fertigen Blätter in die Setzerei. Im Vorzimmer sitzen all die freien Mitarbeiter, die bleich und verzweifelt ihre Texte anbieten oder um einen Vorschuß betteln. Kein Wort von Nazis, von Regierungskrisen, vom Niedergang der Republik. Statt dessen das Lebensgefühl einer Jugend, die gegen die Lebensweise der Eltern aufbegehrte, ohne etwas anderes als Orientierungslosigkeit dagegensetzen zu können. Es ist das Porträt einer Epoche, die rastlos um sich selbst kreiste und darüber alle Widerstandskraft verlor.
Peter de Mendelssohn: "Fertig mit Berlin?" Roman. Elfenbein-Verlag, Berlin 2002. Die Erstausgabe erschien 1930 in der Reihe "Junge Deutsche" des Reclam-Verlages.
Am Freitag lesen Sie an dieser Stelle: "Hier spricht der Gast".
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Walter Klier hält es für eine Glück, dass Peter de Mendelssohn "Fertig mit Berlin?" siebzig Jahren nach seinem ersten Erscheinen nun im Berliner Elfenbein-Verlag neu verlegt worden ist. Klier beschreibt den damals 22-jährigen und heute kaum noch bekannten Autor Mendelssohn als "interessante Figur des Geisteslebens", der unter anderem nach dem Krieg maßgeblich beim Aufbau des "Berliner Tagesspiegels" und der "Welt" mitgewirkt habe. Klier gefällt de Mendessohns nach so langen Jahren wieder ausgegrabenes Buch. Für ihn ist es eine gelungene "Augenblicksbeschreibung der Zeit um 1930" und gleichzeitig eine Liebeserklärung an den Mikrokosmos der Zeitungswelt, den der Autor aus eigener Anschauung kannte.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH