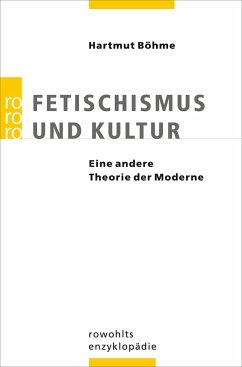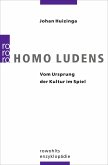Rekonstruiert werden die kulturellen und wissenschaftshistorischen Prozesse von biblischer Zeit bis zur Gegenwart, durch die der Fetischismus zu einem Zentrum der europäischen Kulturen wurde. Fetischismus sollte das «primitive» Verhalten in außereuropäischen Gesellschaften oder bei «perversen» und «entfremdeten» Minderheiten erfassen. Doch das, was archaisch und unaufgeklärt schien, wird zunehmend als das Gegenwärtige, Eigene und Nahe entdeckt. Jean Paul nennt es «dieses wahre innere Afrika», Marx das «Geheimnis der Ware», Freud «das innere Ausland». Dies ist die fetischistische Kultur, in der wir leben. Von hier aus erscheint die Moderne in neuer Sicht. Sie beendet nicht, sondern universalisiert den Fetischismus, der nicht nur in Massenkultur und Konsum, sondern auch in der Politik oder Sexualität triumphiert. Dass der Fetischismus aus der Moderne nicht wegzudenken ist, erklärt sich auch aus der vergessenen Bedeutung, welche die stummen Dinge im Aufbau der Kultur einnehmen.

Hochhackig: Hartmut Böhmes andere Theorie der Moderne
Er stand im Waffenrock vor dem Reichstag, die Hand am Säbelknauf, das Haupt feierlich unbedeckt, den Blick in die Ferne gerichtet, und für Geld konnte man ihn nageln. Für eine Mark gab es einen eisernen, für fünf einen silbernen und für hundert einen goldenen Nagel. Man schlug ihn ins weiche Erlenholz der monumentalen Skulptur, und bald wurde aus dem Generalfeldmarschall ein tausendfach beschlagener "Nagelmann": der Eiserne Hindenburg. Er sollte die Stimmung an der Heimatfront heben und Geld in die Kriegskasse spülen. Unfreiwillig diente er auch der feindlichen Propaganda. 1915 veröffentlichte "The Illustrated London News" eine Doppelabbildung, auf der dem Koloss von Berlin ein Nagelfetisch aus dem Kongo gegenübergestellt wurde. Die Bildüberschrift lautete: "German Counterpart of Westafrican Nail-Driving Fetish-Worship".
Moderne Fetische - bei dem Begriff dürften heute die meisten an Dinge denken, die in den Regalen von Beate Uhse stehen. Für den in Berlin lehrenden Kulturtheoretiker Hartmut Böhme liegt darin eine Reduktion, die selbst einem fetischistischen Bedürfnis entspringt, jenem nach der Bannung des Fetischismus im Dunstbereich des Primitiven bis Perversen. Auch die kurze Karriere des genagelten Hindenburg steht in Böhmes Buch nicht für den kriegsbedingten Rückfall in die Barbarei oder für den Bantu-Charakter der deutschen Kultur, sondern für die innige Beziehung von Fetischismus und Moderne.
Wie er richtig sieht, gehört es zu den Topoi der europäischen Kulturkritik, dass sich der moderne Mensch gerne seiner Rationalität vergewissere, indem er die eigene Irrationalität auf Paria und Exoten projiziere. Die Jagd auf moderne Fetischisten ist ein traditionsreicher Intellektuellensport. Schon Kant hat Priester und Pastoren des "Fetischmachens" überführt, Marx hat die kapitalistische Fetischisierung der Ware aufgedeckt, und Binet und Freud haben fetischistische Praktiken unter der bürgerlichen Bettdecke gelüftet. Bei aller Disparität ihrer Theorien verband diese Geister der Glaube, der Fetischismus sei ein Nachtschattengewächs der Moderne, gesät auf dem Boden der Entfremdung, das im Lichte ihrer Aufklärungsarbeit verkümmern werde. Damit bricht Böhme.
Wiederverzauberte Welt
In einer Moderne ohne Fetischismus, so seine treffende These, würde "nicht das Reich der Freiheit anbrechen, sondern die Gesellschaft zusammenbrechen". Ob in Politik, Kunst, Sport oder Mode, überall setze "die Entzauberung im Namen der Rationalität" mächtige "Energien der Wiederverzauberung" frei, die "auf unklare, bisher kaum analysierte Weise die modernen Gesellschaften integrieren". Mit dieser Schubumkehr des wissenschaftlichen Fetischismusdiskurses gelingt ihm tatsächlich, was der Untertitel des Buches vollmundig verspricht: Er legt den Weg frei für "eine andere Theorie der Moderne". Wie weit er auf ihm kommt, wird noch zu sehen sein.
Ausgangspunkt ist seine Beobachtung, dass die klassischen Theoretiker der Moderne in einem Denksystem gefangen seien, das von der Moderne nur erfasse, was an ihr modern sei. Ihre Fixierung auf funktionale Ausdifferenzierung, Verfahrensrationalität, Technisierung, Verwissenschaftlichung oder Demokratisierung sei an "normative Optionen" gebunden, die wiederum auf eine Stärkung der aufgeklärten Gesellschaft zielten. Böhme bricht dieses zirkuläre System auf, indem er die klassischen Modernisierungstheorien nicht im Stil eines Bruno Latour verwirft und die Moderne gleich mit entsorgt, sondern indem er ihre blinden Flecken sichtbar macht und theoretisch ausfüllt.
Luhmann konterkarierend, demonstriert er etwa am Warenfetischismus der Haute Couture, dass die moderne Ökonomie gerade deshalb erfolgreich operiere, weil sie funktional wenig ausdifferenziert sei und ihr Systemcode "Zahlen/Nicht-Zahlen" vom religiösen Code "Transzendenz/Immanenz" überlagert werde. Von der Einsicht in diese Produktivität der Widersprüche verspricht sich Böhme einen selbstbewussteren und spielerischeren Umgang mit fetischistischen Bedürfnissen. Damit bekennt auch er sich zum aufklärerischen Credo an die Wonnen des Wissenden - ein sympathischer Standpunkt, der aber Gefahr läuft, die Macht aus dem Spiel zu mogeln.
Böhme skizziert seine Theorie in wenigen prägnanten Strichen zu Beginn des Buches. Wer nun gespannt auf ihre Konkretisierung am historischen Gegenstand wartet, wird enttäuscht. Schon die Erläuterung des Fetischismusbegriffs fällt wenig erhellend aus. Böhme hält nichts davon, ihn auch nur ansatzweise einzuschränken, weil alle seine Ausfächerungen eine verborgene Selbstbeschreibung europäischer Gesellschaften darstellten. Dem mag so sein - "jeder Maler malt sich selbst", wie schon Leonardo wusste -, als analytische Kategorie ist der Fetischismus damit aber erledigt. Wo er beginnt, wo er aufhört, wird mit fortdauernder Lektüre immer diffuser.
Klammergriff der Dinge
Gleichzeitig geht Böhmes "andere Theorie" im Rauschen des wissenschaftlichen Fetischismusdiskurses unter. Anstatt die behauptete Funktionalität fetischistischer Praktiken in der westlichen Politik, Wirtschaft oder Wissenschaft nachzuweisen, betritt er den ausgetretenen Pfad der Literaturgeschichte. Auf ihm macht er bei den üblichen Verdächtigen, kaum aber bei Unbekannten halt. Freimütig räumt er ein, dass ihm andere vorgearbeitet haben, in Deutschland etwa Karl-Heinz Kohl mit seiner fundierten Studie über "Die Macht der Dinge" von 2003. Damals hat ihm Böhme in der "Süddeutschen Zeitung" noch vorgeworfen, er präsentiere eine "Große Erzählung" der Fetischismusgeschichte, anstatt den Begriff "auf die vertrackten Objektbeziehungen der modernen Kulturen" zu richten. Nun fällt der Vorwurf auf ihn selbst zurück.
Obwohl in seinen Textdeutungen immer wieder originelle Ideen und faszinierende Theoriefetzen aufblitzen, verliert er in den Verästelungen der Forschungsgeschichte die anfängliche Fragestellung aus den Augen. Und im Bedürfnis, die Fetischismusforscher als die wahren Fetischisten zu entlarven, macht er aus dem Begriff wieder das, wovon er ihn zu Beginn befreien wollte: ein Bezichtigungsinstrument.
So bleibt das Verhältnis von Fetisch und Vernunft bis zum Schluss in der Schwebe. Füllt der Fetischismus das Vakuum an Rausch und Zauber, das die ernüchternde Vernunft hinterlässt? Oder stellt er der Vernunft das Bein? Oder hilft er ihr gar auf die Sprünge? Folgt man wie Böhme einem wissenschaftsgeschichtlichen Interesse, dürfte letztere Hypothese die interessanteste sein. Dass die wissenschaftliche Objektivität eines Objektkultes bedarf, der fetischistische Züge trägt, lässt sich an den Anfängen der Verwissenschaftlichung besonders gut verfolgen. Botaniker sammelten Pflanzen als Bestandteile eines wiederherzustellenden Garten Eden, Zoologen sezierten und klassifizierten Tiere als Verkörperungen des Schöpfungsplans, Numismatiker horteten und studierten römische Münzen als Träger der authentischen Kaisergesichter, und Philologen suchten in ihren Handschriften nach dem "reinen und ganzen" Urtext, den es "mit höchster Demut" freizulegen gelte.
Die sich als neue Aufklärer vorkommenden Frankfurter haben diesen Objektkult als Atavismus eines mythologischen Denkens verlacht, übersahen dabei aber, dass er die Energiequelle für die Erkenntnisgewinne war, auf denen sie selber aufbauten. Die Vernunft ist nur der Motor, nicht der Treibstoff der Erkenntnis.
CASPAR HIRSCHI
Hartmut Böhme: "Fetischismus und Kultur". Eine andere Theorie der Moderne. Rowohlt Verlag, Reinbek 2006. 570 S., br., 16,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Das hätte was werden können, seufzt Caspar Hirschi. Die erhoffte "Schubumkehr" des Fetischismusdiskurses durch eine Theorie der Moderne, in der dem Fetischismus eine tragende Rolle zukommt, bleibt ihm der Kulturtheoretiker Hartmut Böhme leider schuldig. So sympathisch Hirschi der Ansatz zu einem selbstbewussteren Umgang mit fetischistischen Bedürfnissen auch ist, so vergebens wartet er auf Konkretisierungen jenseits ausgetretener Wege, sucht er nach analytischer Tiefenschärfe des Begriffs. Das Aufblitzen "faszinierender" Theoriepartikel im Text reicht dem Rezensenten nicht. In der Rückschau erscheint ihm das Projekt sogar als gescheitert, weil es dem Autor nicht gelingt, den Fetischismus-Begriff von seinen alten Fesseln zu befreien.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Begeisterung hat Hartmut Böhmes Studie über die Zusammenhänge von Fetischismus und Kultur bei Rezensent Thomas Assheuer ausgelöst. Er würdigt das Werk als eine kritische Reflexion der Moderne, der Böhme weniger Aufgeklärtheit bescheinigen will als das üblich ist. Dem Befund, der Fetischismus sei vital wie eh und je, kann sich Assheuer nur anschließen - unübersehbar nämlich sind für ihn die modernen Kultformen wie Food- und Sexfetischismus, Starkult, Verehrung des Automobils, Apotheose des Sports und die Lust am Konsum. Böhme deute diese Kultformen als Ersatz für die aufgelösten alten Feste und Riten und bescheinige ihnen eine wichtige Funktion für den sozialen Zusammenhalt und die Affektbindung. Die Kapitel über Karl Marx' Ansichten zum Warenfetischismus sind für Assheuer ein besonderer Genuss. Dass Böhme Marx vorwirft, er habe mit seiner Kritik der Ware einen neuen Begriffsfetischismus entfacht, findet Asshauer durchaus delikat, schließlich scheint ihm Böhmes Arbeit bei aller Brillanz selbst nicht ganz frei von Fetischen zu sein. So bleibt es seines Erachtens nicht aus, dass der Autor seine eigene Theorie fetischisiert. Doch das stört ihn angesichts der zahlreichen Einsichten und der glänzenden Formulierungen, mit denen Böhme aufwartet, nicht weiter.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH