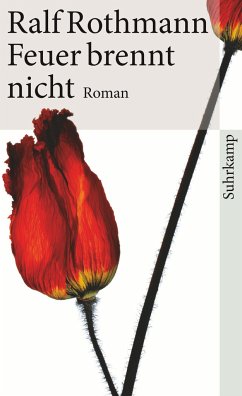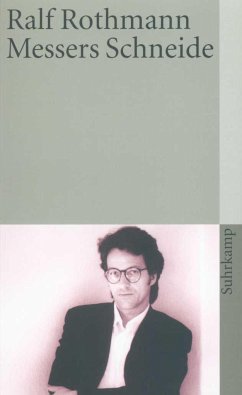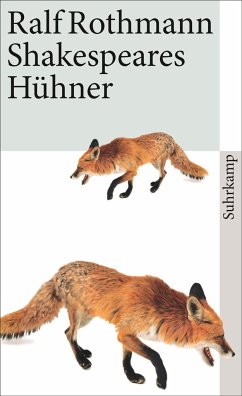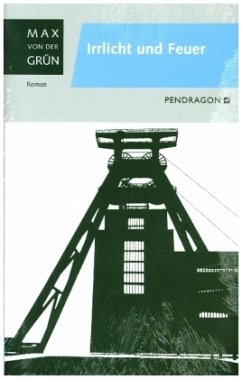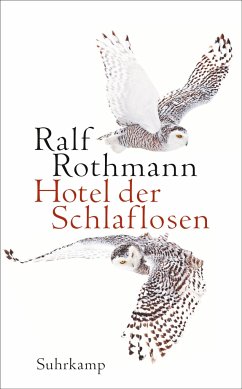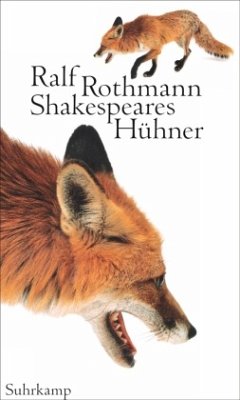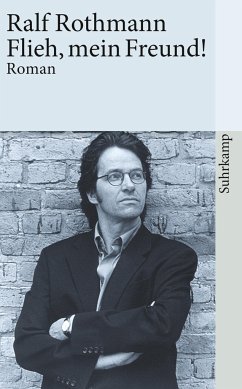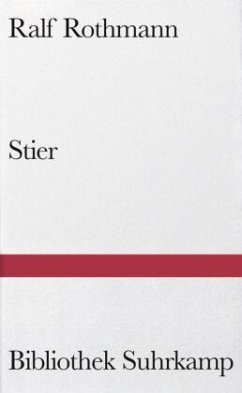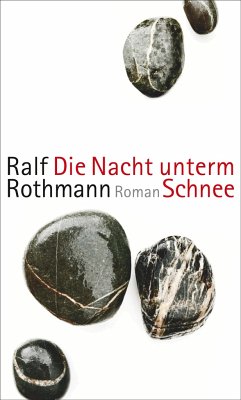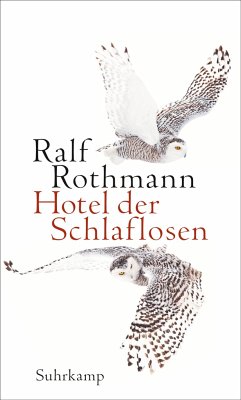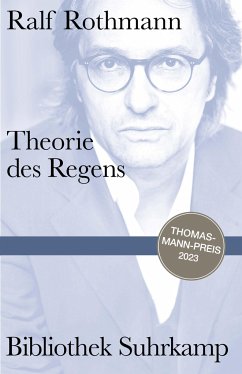Feuer brennt nicht
Roman
Versandkostenfrei!
Liefertermin unbestimmt
19,80 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:
Berlin, fast zwanzig Jahre nach dem Mauerfall. Kreuzberg ist gesichtslos geworden, in den Szenebezirken lebt man auf zu dünnem Eis ('man hört es leise knacken, wenn sie die Deckel ihrer Laptops schließen'), und so ziehen Alina und Wolf an den grünen Rand der Stadt. Am Müggelsee, wo die Unterschiede zwischen Ost und West noch nicht verwischt sind, dem Ort erstaunlicher Begegnungen mit Menschen aus der untergegangenen Republik, sieht Wolf sich aber zunehmend überfordert von dem alltäglichen Zusammenleben mit Alina, den 'Details der Zweisamkeit', der Enge trotz komfortabler Wohnung.
Als plötzlich Charlotte auftaucht, eine Geliebte aus der Vergangenheit, ergreift er die Flucht in neue, vom offensiven Eros der Professorin befeuerte Sensationen - getarnt als Ausflüge mit seinem Labrador Webster. In dessen Fell hält sich der fremde Parfümduft jedoch unvermutet lange. Alina wird skeptisch, und so überwindet Wolf 'die Hölle der Verheimlichung' und ist überrascht: Seine Frau akzeptiert das Verhältnis zu der Anderen nicht nur, sie ermuntert ihn sogar dazu ...'Heute noch etwas erfinden heißt, der Wahrheit verloren gehen.' Ralf Rothmann hat einen Roman über das behutsame Zusammenwachsen von Ost und West und eine Chronik des erotischen Begehrens geschrieben, eine dunkel-glühende Liebesgeschichte.
Als plötzlich Charlotte auftaucht, eine Geliebte aus der Vergangenheit, ergreift er die Flucht in neue, vom offensiven Eros der Professorin befeuerte Sensationen - getarnt als Ausflüge mit seinem Labrador Webster. In dessen Fell hält sich der fremde Parfümduft jedoch unvermutet lange. Alina wird skeptisch, und so überwindet Wolf 'die Hölle der Verheimlichung' und ist überrascht: Seine Frau akzeptiert das Verhältnis zu der Anderen nicht nur, sie ermuntert ihn sogar dazu ...'Heute noch etwas erfinden heißt, der Wahrheit verloren gehen.' Ralf Rothmann hat einen Roman über das behutsame Zusammenwachsen von Ost und West und eine Chronik des erotischen Begehrens geschrieben, eine dunkel-glühende Liebesgeschichte.