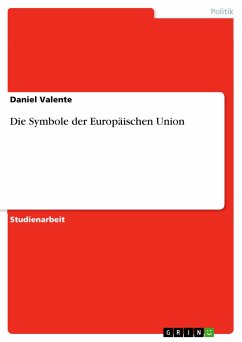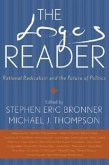Wie sehr sich der buchstäbliche Sinn der Souveränität seit den Tagen Bodins und Hobbes' verdunkelt haben mag, die Figur der Souveränität hört nicht auf, auch moderne, 'dezentrierte' Gesellschaften, die die souveräne Macht dem Gesetz der Gewaltenteilung unterwerfen, heimzusuchen. Souveränität verweigert sich nicht nur hartnäckig der Historisierung, sondern zugleich auch der Alternative von moralischer Affirmation oder Verwerfung. Souveräne sind nicht bloß ausgezeichnete öffentliche Amts- und Würdenträger oder diejenigen, die sie mit souveräner Macht investieren. Die souveräne Funktion ist in einem gewissen Vermögen verankert, in der Fähigkeit, das Gesetz zu geben oder es im Ausnahmefall zu suspendieren. Souveräne Macht kann aber auch im Widerspruch und in der Manifestation gegen eine bestimmte institutionalisierte Herrschaftsordnung zum Ausdruck kommen, in der Beanspruchung einer Gleichheit durch diejenigen, die ungleich sind oder denen ein gleicher Anteil an der politischen Ordnung verweigert wird. Die Untersuchungen spannen einen Bogen, der von den klassischen Texten der antiken politischen Philosophie über die frühneuzeitlichen Souveränitätslehren bis hin zur politischen Ontologie Martin Heideggers reicht. Da die rechtsetzende Gewalt mit den Techniken der vorgängigen Figuralisierung oder Sichtbarmachung eines Raumes sowie mit der Entwicklung komplexer expressiver Codes, Wissensformen und Subjektivierungstechniken verbunden ist, wird die Lektüre der philosophischen Texte durch die Analyse solcher literarischen Werke (Sophokles, Shakespeare, Montaigne, Racine, Kafka) ergänzt, in denen die Probleme und Aporien, die Widersprüche und Störungen der politischen Verkörperung auf eine zugespitztere Weise verhandelt werden als in der politischen Theorie.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Politische Macht hat viele Gesichter: Friedrich Balke untersucht, was die neuzeitlichen Souveränitätslehren von ihren mittelalterlichen Vorgängertheorien unterscheidet.
Das Bild, das Hegel, der vermeintliche Apologet des preußischen Obrigkeitsstaates, von der Rolle des Herrschers zeichnet, ist wenig schmeichelhaft. Der Monarch sei nichts weiter als "ein mehr oder weniger abstrakter Mittelpunkt innerhalb für sich bereits ausgebildeter und durch Gesetz und Verfassung feststehender Einrichtungen". Nicht anders als der letzte seiner Untertanen gehöre er einer bestehenden Ordnung der Gesellschaft an und erscheine daher "nicht als die selbständige, totale und zugleich individuell lebendige Gestalt dieser Gesellschaft selber, sondern nur als ein beschränktes Glied derselben".
Auf den ersten Blick liegt ein Abgrund zwischen Hegels Verbeamtung des Herrschers und dem anderthalb Jahrhunderte früher von Hobbes entworfenen Modell einer absorptiven Repräsentation der Bürger durch den Souverän. Der um Verfallsdiagnosen niemals verlegene Carl Schmitt hat die auf Hobbes folgende politische Philosophie denn auch der inneren Aushöhlung des mächtigen Leviathan geziehen. Eine eindrucksvolle Gegenerzählung zu dieser wirkmächtigen Dolchstoßlegende legt der Weimarer Kulturphilosoph Friedrich Balke vor.
Was die neuzeitlichen Souveränitätslehren von ihren mittelalterlichen Vorgängertheorien unterscheidet, ist, wie Balke hervorhebt, ihr Ausgangspunkt: das Volk. "Wie absolut die Macht des Fürsten auch immer sein mag: Er verdankt sie weder einfach sich selbst noch göttlicher Berufung, sondern einem Akt der Einsetzung durch diejenigen, die ihm im Anschluss an diesen, wie auch immer im einzelnen vorgestellten Vorgang unterworfen sind." Dies beinhaltet einen geltungstheoretischen Primat der Volkssouveränität gegenüber der Herrschersouveränität. "Das Volk wird einmal souverän gewesen sein müssen, um sich anschließend für immer in einer anderen Person verkörpern zu können."
Ist es aber ernsthaft plausibel, dem Volk den Willen zu seiner politischen Selbstentmachtung zuzuschreiben? Hobbes nimmt dies bekanntlich an. Seine Naturzustandsdarstellung verfolgt den Zweck, die Selbstunterwerfung als Bedingung der Möglichkeit des eigenen Überlebens zu erweisen. Der Gehorsam gegenüber dem Souverän beruht der Logik von Hobbes' Konzeption zufolge letztlich darauf, dass die kühl kalkulierende instrumentelle Vernunft der einzelnen Untertanen ihn als zweckmäßig bewertet. In dieser Zuspitzung liegt eine Funktionalisierung der Herrscherrolle, die noch weit radikaler ist als die Position Hegels.
Sie hat freilich ihren Preis. Auf dem schwankenden Grund individueller Nutzenkalkulationen errichtet, bleibt das Regime des Leviathan in Balkes Worten "unaufhebbar prekär". Diese Instabilität muss überwunden werden, und dazu bedarf es einer Stärkung der Gehorsamsmotive. Die von Carl Schmitt als Degenerationsprozess gedeutete nachhobbesianische Staatsphilosophie und Staatspraxis stellt sich für Balke deshalb gerade umgekehrt als der Versuch dar, die Autorität des Staates unter den neuen souveränitätstheoretischen Rahmenbedingungen zu befestigen.
Bereits Spinoza erkennt, dass die größte Herrschaft derjenige innehat, der über die Herzen der Untertanen gebietet. Die Rechtsgesetze müssten daher zugleich in der Vernunft und in der den Menschen gemeinsamen Affektivität ihre Stütze haben. Wie aber lässt sich dieses Ziel am besten erreichen? Spinoza selbst empfiehlt eine möglichst umfassende Beteiligung aller Bürger an der Regierung.
Einen anderen Weg schlägt der französische Absolutismus ein. Wie Balke unter Berufung auf Montaigne und Pascal darlegt, ist auch dort die königliche Würde allem rhetorischen Prunk zum Trotz nicht mehr in einer höheren Natur oder einem königlichen Wesen verankert, sie residiert vielmehr ausschließlich in den äußeren Attributen des Königtums. "Der König ist nackt, er weiß um seine wirkliche Situation, kann und darf sie aber nicht akzeptieren. Er weiß, dass er kein Herrscher ist, dass es vielleicht niemals mehr einen Herrscher, der diesen Namen verdient, geben wird; er stellt deshalb aber nicht etwa sein Amt zur Verfügung, sondern verlegt sich auf die Strategie, den Herrscher, der er nicht ist, zu zeigen."
Damit begibt sich der Herrscher freilich ebenfalls in die Hände seiner Untertanen. Sie müssen sein Verhalten mit ihren Erwartungen an ein königliches Auftreten in Übereinstimmung bringen können. Insofern ist auch die sich als absolut gerierende Herrschaft "paradoxerweise von der Zustimmung derer abhängig, die sie beherrscht".
Ein dritter Weg, auf dem die Gehorsamsbereitschaft der Bürger erhöht werden kann, ist Balke zufolge der totalitäre. Die "guten Bürger" eines totalitären Staates warten nicht erst auf den ausdrücklichen Befehl der Regierung, um tätig zu werden, denn sie verstehen die Anliegen des Staates unmittelbar als ihre eigene Sache. Damit eliminieren sie die von Hobbes noch ganz selbstverständlich vorausgesetzte Grenze zwischen privat und öffentlich.
"Der Souverän Hobbesschen Typs hat zwar ein Recht auf alles, aber seine Herrschaft erstreckt sich ausdrücklich nicht auf die innere Handlung des Gemütes; der totale Staat dagegen ist durch den Liberalismus ,hindurchgegangen', da er die Freiheit des Individuums zwar negiert, insofern sie in Form von Beschränkungen staatlicher Hoheitsrechte artikuliert wird, diese Freiheit aber zugleich voraussetzt und ,aktiviert', weil seine Existenz mit der Erzeugung einer totalen Folgebereitschaft steht und fällt, die einem bloßen Tyrannen, der über furchtsame Bürger herrscht, gerade versagt ist." Im Nachweis der jedenfalls partiellen funktionalen Äquivalenz von demokratischen und totalitären Legitimationsbeschaffungsstrategien liegt die der heutigen politikphilosophischen Orthodoxie vermutlich schmerzlichste Pointe von Balkes Buch.
Im Vergleich zu den Gefahren einer übermäßigen Politisierung der Bürgerschaft ist Hegels Modell einer Profanierung und engen rechtlich-institutionellen Einhegung politischer Macht die risikoärmere Option. Die prosaischen Züge dieses Modells erregen freilich regelmäßig den Unmut politischer Romantiker Plettenberger, Frankfurter oder Pariser Provenienz. Auch Balke hält es für "erschreckend", dass die moderne souveräne Machtausübung sich auf dem Feld der Regierungspraktiken und des alltäglichen Verwaltungshandelns abspiele. "Liegt hier nicht eine Verwechselung polizeilicher mit politischen Aufgaben vor?" Ist Politik "nicht vielmehr unablösbar von der Stiftung einer gewissen Unordnung und Unruhe?". Nun für die Unruhe sorgen schon die Wahlkämpfe. Dafür, dass sich nach einem Regierungswechsel in der Sache zumeist nur wenig ändert, sorgen das Haushaltsrecht und die Ministerialbürokratie. Und das ist gut so.
MICHAEL PAWLIK.
Friedrich Balke: "Figuren der Souveränität".
Wilhelm Fink Verlag, München 2009. 545 S., geb., 58,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
In ihrer eingehenden Besprechung von Jacques Derridas "Seminaire La bete et le souverain" wirft Sonja Asal auch einen Seitenblick auf Friedrich Balkes Habilitationsschrift "Figuren der Souveränität". Die Arbeit kann sie deshalb nicht überzeugen, weil die disparaten Einzelstudien zu Antigone, Hobbes oder Kafka nur mühsam unter dem Titel zusammengehalten werden und bei geradezu "leitmotivischer" Verwendung von Derridas Begriff der "Biopolitik" zu nicht gerade plausiblen Deutungen kommen. Vielleicht, überlegt die Rezensentin, ist die "florierende" Forschungsliteratur zum Thema auch einfach mal an ihr natürliches Ende gekommen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH